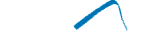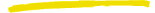25. Tätigkeitsbericht (2003)
2 |
Der Weg in die Informationsgesellschaft
|
| |
|
|
|
Wenn sich zu Überwachungseifer auch noch Regelungswut gesellt
|
|
Verschlankung, Verwaltungsmodernisierung, Deregulierung und Rückführung
des staatlichen Sektors sind längst keine abstrakten Programmsätze
mehr, sondern werden von Politik und Verwaltung auch tatsächlich
zunehmend realisiert. In einem Bereich tobt sich dagegen die staatliche
Regelungswut, unbeeindruckt vom Geschehen ringsherum, ungebremst
aus: Wenn es um die Überwachung der Telekommunikation geht,
spielen Kosten, Normenflut und fehlende Transparenz offenbar plötzlich
keine Rolle. Die fixe Idee, es dürfe keine ”abhörfreien”,
nicht überwachten Bereiche der Telekommunikation geben, hat
in den vergangenen Jahren zu einer solchen Fülle von neuen
Gesetzen, kurzatmigen Gesetzesnovellierungen und permanenten Anpassungen
von untergesetzlichen Vorschriften geführt, dass sich in dem
entstandenen Paragraphendschungel auch Fachleute nur noch schwer
zurechtfinden. Die meisten Bürger haben längst den Versuch
aufgegeben, durch einen einfachen Blick ins Gesetz klären zu
wollen, ob ihre persönliche Telekommunikation abgehört
oder sonst wie überwacht werden kann. Viele haben resigniert
und rechnen vorsichtshalber damit, dass der Staat hemmungslos abhört
und überwacht. Unternehmen der Telekommunikation beklagen sich
darüber, dass ihnen durch permanente komplizierte Neuerungen
in den gesetzlichen Vorschriften der Überblick und damit eine
sichere Kalkulationsgrundlage entzogen wird. Dabei fing alles so überschaubar an, als 1968 nach heftigen
politischen Auseinandersetzungen im Zuge der Notstandsgesetze
erstmals das Abhören von Telefongesprächen erlaubt wurde.
Seitdem wurde der einschlägige § 100 a Strafprozessordnung
(StPO) über ein Dutzend Mal geändert - immer wurden dabei
die Abhörmöglichkeiten erweitert, niemals eingeschränkt.
Ein neues Zeitalter der Überwachung begann 1997 mit dem In-Kraft-Treten
des Begleitgesetzes zum Telekommunikationsgesetz, denn es
ließ fortan nicht nur die Überwachung des ”Fernmeldeverkehrs”,
sondern der gesamten Telekommunikation und damit aller Kommunikationsformen
der neuen Medien zu. Infolge der Privatisierung der Telekommunikation
wurden nicht nur der Post-Nachfolger Telekom, sondern alle geschäftsmäßigen
Erbringer von Telekommunikationsdienstleistungen in die Pflicht
genommen. Die Einzelheiten regelt die Telekommunikationsüberwachungsverordnung,
die nach langwierigen Debatten im Windschatten des 11. September
2001 ohne viel Aufheben verabschiedet wurde (vgl. 24. TB, Tz. 8.3). Zu Jahresbeginn 2002 traten die neuen §§ 100 g und 100 h StPO in Kraft, die den alten § 12 Fernmeldeanlagengesetz ablösten und die Nutzung von Verbindungsdaten, die im Rahmen der Digitalisierung nunmehr vollständig erfasst werden, neu regeln. Seitdem kann ein richterlicher Beschluss auch die Erfassung von Verbindungsdaten für die Zukunft anordnen. ”Nebenbei” wird in der Gesetzesbegründung ”klargestellt”, dass die IP-Nummern, falls sie - in der Regel unzulässigerweise - bei den Access-Providern im Internet erfasst werden, nicht den neuen §§ 100 g und 100 h StPO unterliegen, sondern nach § 89 Abs. 6 Telekommunikationsgesetz zu beurteilen sind. Sie sind also auf Anforderung von Sicherheitsbehörden und ohne richterlichen Beschluss herauszugeben. Schon 1996 wurde in § 90 TKG geregelt, dass Telekommunikationsanbieter
Kundendateien zu führen haben, auf die die Sicherheitsbehörden
unbemerkt von den Anbietern zugreifen können. Bei im Voraus
bezahlten Telefonkarten für Handys brauchen die Anbieter eigentlich
keine Kundendaten - im Gegenteil, die Bestimmungen zu Datenvermeidung
und Datensparsamkeit verbieten ihnen das unnötige Datenspeichern
in diesen Fällen. Das dachten zu Recht auch einige Telekommunikationsunternehmen
und weigerten sich, dem Verlangen der Sicherheitsbehörden nach
Speicherung von Kundendaten auch beim Kauf von Prepaid-Karten nachzukommen.
Sie klagten gegen entsprechende Auflagen der Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und Post; sie wollten keine Kundendaten
ohne Notwendigkeit speichern. Als sie beim Verwaltungsgericht Köln
Recht bekamen (vgl. 23. TB, Tz. 8.1),
wurde sofort der Bundesgesetzgeber aktiv und ließ verlautbaren,
man werde diese ”Lücke” im TKG umgehend im Sinne
der Sicherheitsbehörden schließen. Zwischenzeitlich hat
das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass nach seiner
Rechtsauslegung angeblich bereits der bestehende § 90 TKG die
Anbieter verpflichtet, auch die Kundendaten von Prepaid-Karten
im Interesse der Sicherheitsbehörden zu erheben und zu speichern.
Gleichwohl will der Bundesgesetzgeber - sicher ist sicher - den
§ 90 noch einmal eindeutig in Richtung auf Datenerfassung und
Weitergabe an die Sicherheitsbehörden ”überarbeiten”.
Bei dieser Gelegenheit soll dann auch gleich insgesamt der Katalog
der von allen Kunden zu erfassenden Daten erweitert und die systematische
Suche in den riesigen Kundendatenbanken perfektioniert werden (vgl.
Tz. 8.4). War noch ein Wunsch offen? In der Tat, Handys haben die schöne
Nebenwirkung, dass man feststellen kann, wo sich der Besitzer gerade
befindet. Das Handy als ein Peilsender, den inzwischen fast jeder
mit sich herumträgt, das stand auf der Forderungsliste der
Sicherheitsbehörden seit Jahren ganz oben. Der Einsatz des
IMSI-Catchers, der die Ortung von mobilen Endgeräten
wie Handys ermöglicht, war jahrelang umstritten. Nach dem 11.
September 2001 wurde seine Nutzung im Rahmen der Antiterrorgesetzgebung
zunächst den Geheimdiensten erlaubt, mit Gesetz vom 06.08.2002
nunmehr auch den Strafverfolgungsbehörden durch Einfügung
eines neuen § 100 i in die StPO. Warnungen von Fachleuten,
der IMSI-Catcher gehöre eigentlich strikt verboten, statt ihn
bei den Sicherheitsbehörden hoffähig zu machen, weil er
in den Händen von Kriminellen viel Unheil anrichten kann, wurden
in den Wind geschlagen. In all den Jahren wurden stets auch die Befugnisse der Zollfahndung
nach § 39 Außenwirtschaftsgesetz, wonach die Telekommunikation
sogar zur ”Verhütung” bestimmter Straftaten
überwacht werden darf, ”mitverbessert”. Ebenso wenig
kamen die Geheimdienste bei den verschiedenen ”Gesetzesoptimierungen”
zu kurz. Sie liefen bei den Gesetzesverschärfungen mehr oder
weniger geräuschlos ”mit”. Im Terrorismusbekämpfungsgesetz
von 2002 erhielten sie erstmals direkten Zugriff auf Telekommunikationsverbindungsdaten
und auf Nutzungsdaten. Der Einsatz des IMSI-Catchers wurde den Geheimdiensten
sogar früher als der Polizei erlaubt. Niemand sollte meinen, diese Aufzählung sei vollständig.
Die vielen Einzelheiten und kleineren ”Flurbereinigungen”
des Überwachungsarsenals können hier aus Platzgründen
gar nicht dargestellt werden. Die gesamte Rechtslage der Überwachung
der Telekommunikation ist kompliziert und unübersichtlich.
Der perfektionistische Anspruch, mit dem der Bund die Überwachungsgesetzgebung
seit Jahren kontinuierlich betreibt, hat zu einem Flickenteppich
von sich in Teilen überschneidenden, nicht sauber abgegrenzten
Überwachungsbestimmungen geführt, den nur noch wenige
überblicken. Aber er zeigt die gewünschte Wirkung: Die
Überwachung der Telekommunikation nimmt jährlich gravierend
zu. Selbst wenn man die allgemeinen Steigerungszahlen der Nutzung
der Telekommunikation einkalkuliert, ergibt sich, dass die Überwachung
schneller wächst als die Telekommunikation. In der Literatur
ist davon die Rede, Deutschland habe sich in den vergangenen Jahren
zu einem Abhörparadies entwickelt. Fehlt noch etwas? Ja, im Teledienstedatenschutzgesetz haben sich
bis heute ein paar Bestimmungen wacker gehalten, die, wenn sie beachtet
würden, den Internet-Nutzern durchaus eine Chance auf Datenschutz
ließen. Dort ist nämlich zum Beispiel geregelt, dass
die Inanspruchnahme von Telediensten anonym oder unter Pseudonym
möglich sein soll. Personenbezogene Daten dürfen von den
Providern allenfalls dann gespeichert werden, wenn dies für
Abrechnungszwecke erforderlich ist. Die Anbieter von Webseiten im
Internet dürfen Daten ihrer Besucher also nicht speichern und
die Zugangsprovider nur insoweit, wie dies für Abrechnungszwecke
erforderlich ist. Nun weiß jeder Praktiker, dass dies keineswegs
überall beachtet wird, sodass über Internet-Surfer an
vielen Stellen heimlich und rechtswidrig Daten aufgezeichnet werden.
Selbst wenn Kunden eine Flatrate haben, also die Zeit, in der sie
im Internet surfen, gar nicht abrechnungsrelevant ist, speichern
einige Provider das Surfverhalten ihrer Kunden. Andere Anbieter
halten sich aber an das Gesetz und könnten mit den neuen Instrumenten
Audit und Gütesiegel
sogar um Kunden werben. Der von uns gemeinsam mit der TU Dresden
betriebene Anonymisierungsdienst AN.ON
(vgl. Tz. 9.2) erfreut sich nicht
nur der Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium, sondern
hat obendrein den Charme, durch und durch gesetzmäßig
zu sein. Rechtswidrig ist nach dem Teledienstedatenschutzgesetz
nämlich nicht das anonyme Nutzen des Internets, sondern das
Speichern von Daten über das Surfverhalten. Wer Systeme wie AN.ON
nicht nutzt, muss damit rechnen, dass sein Surfverhalten aufgezeichnet
und ausgewertet wird. Aber es geht eben nicht ”nur” um
das Surfverhalten, sondern im Kern wird registriert, wofür
die Bürgerinnen und Bürger sich interessieren, wie lange
sie sich welche Seiteninhalte ansehen, welchen nächsten Klick
sie vollziehen, woran sie also vermutlich als Nächstes gedacht
haben usw. Da die Zahl der Internet-Nutzer in Deutschland ständig
zunimmt, in Schleswig-Holstein sogar überproportional, wächst
mit den im Internet protokollierten Surfdaten ein Überwachungs-
und Ausforschungspotenzial heran, das seinesgleichen nirgendwo
in der konventionellen Welt hat. In dieser Situation bräuchten
die Bürger eigentlich Schutz und Hilfe vom Staat, damit die
im Teledienstedatenschutzgesetz gesetzlich versprochene anonyme
oder pseudonyme Nutzung des Internets überhaupt in Anspruch
genommen werden kann. Die Signale der Bundespolitik gehen leider genau in die entgegengesetzte
Richtung. Statt den Sammlern rechtswidriger Protokolldatenbestände
das Handwerk zu legen, soll das Protokollieren nicht nur gesetzlich
erlaubt, sondern, wennschon - dennschon, gleich auch noch ausdrücklich
vorgeschrieben werden. Die Vorstöße hierzu kommen aus
den unterschiedlichsten Richtungen. Mal sind es Initiativen aus
Brüssel, mal mahnt die Bundesratsmehrheit die Speicherung von
Vorratsdaten an. Noch hält das Teledienstedatenschutzgesetz;
es wurde sogar im Berichtszeitraum in einer Novellierung, inklusive
Anspruch auf anonyme oder pseudonyme Internet-Nutzung, bekräftigt.
Aber die Begründungen der Bundesregierung bei der Ablehnung
des Bundesratsentwurfs zur verpflichtenden Einführung der Vorratsspeicherung
klingen nicht so, dass man allzu hohe Wetten darauf abschließen
möchte, dass dies unter allen Umständen auch morgen noch
gilt. Zu unerbittlich und konsequent sind in den vergangenen Jahren
”Überwachungslücken” geschlossen worden, als
dass man glauben könnte, der Gesetzgeber werde vor der Anordnung
der Vorratsspeicherung dann doch zurückschrecken. Davon, dass
die Politik ihr Augenmerk auf die ganz andere Seite richten könnte,
nämlich den Datenschutz der Internet-Nutzer endlich auch in
der Praxis durchzusetzen, mag man gar nicht mehr träumen ... So sind wir denn, was die Einführung einer verpflichtenden
Vorratsdatenspeicherung angeht, wieder einmal am Scheideweg
angelangt: Traut der Staat seinen Bürgern, oder misstraut er
ihnen von vornherein? Wer den Bürgern misstraut, der kann es
auch nicht riskieren, ihnen eine anonyme Nutzung des Internets zuzugestehen.
Er muss, ähnlich wie der griechische Philosoph Platon in der
Geschichte vom Ring des Gyges, dafür plädieren, den Menschen
nie, auch nicht für wenige Augenblicke, ohne Überwachung
zu lassen, weil er dies sofort zu kriminellen Handlungen nutzen
würde. Aus diesem abgrundtiefen Misstrauen gegen die Menschen
resultiert bekanntlich ein Staatsideal Platons, das totalitären
Regimen näher steht als unseren Vorstellungen von Demokratie.
Bislang gingen wir immer davon aus, dass die Freiheit jedes Einzelnen
das vorrangige Prinzip ist, in das der Staat nur ausnahmsweise und
bei Vorliegen definierter Voraussetzungen eingreifen darf. Man muss
allerdings einräumen, dass sich die Polizeirechts- und generell
die Sicherheitsgesetzgebung seit Jahren auf einem Weg befindet,
bei dem rechtsstaatliche Sicherungen systematisch eingeebnet
werden. Wenn es nicht mehr darauf ankommt, ob jemand als Störer
oder Verdächtiger eine objektive Ursache gesetzt hat, sondern
Eingriffsmaßnahmen genauso gut gegen ”andere Personen”
zugelassen werden, kann letztlich jeder betroffen sein. Und wenn
für Rechtseingriffe nicht mehr eine polizeirechtliche Gefahr
vorliegen muss, sondern die Absicht der ”Gefahrerforschung”
ausreicht und im Rahmen der ”vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten” nicht einmal der Anfangsverdacht einer Straftat
vorliegen muss, sondern dieselben Eingriffsinstrumente wie zur Straftatenauf-klärung
bereits unterhalb der Schwelle eines Anfangsverdachts eingesetzt
werden dürfen, dann kann auch niemand mehr vorhersehen, in
welchen Situationen er in Überwachungsmaßnahmen gerät.
Die Einführung einer verdachtslosen Vorratsspeicherung im Internet
würde die Überwachung noch weiter nach vorne verlagern.
Absolut jeder wäre zunächst zu erfassen, die Unverdächtigen
würden erst später ausgesondert. Mit unserer Aktion ”Rote
Karte für Internet-Schnüffler” (vgl. Tz. 8.5)
setzen wir uns dafür ein, dass auch im Internet das verfassungsrechtliche
Verbot der Speicherung von Daten auf Vorrat zu unbestimmten Zwecken
beachtet wird und Eingriffsmaßnahmen gegen die Nutzer des
Internets nur beim Vorliegen des Anfangsverdachts einer strafbaren
Handlung ergriffen werden dürfen. Mit unseren bescheidenen
Mitteln haben wir im Berichtszeitraum untersucht, ob diejenigen,
die mithilfe unseres AN.ON-Dienstes
das Internet anonym nutzen, diese Freiheit missbrauchen. Nach unseren
Feststellungen tut dies nur eine verschwindend kleine Minderheit.
Bei 1,2 Millionen Nutzungen im untersuchten Zeitraum konnten wir
gerade einmal 17 Fälle feststellen, in denen möglicherweise
der Anfangsverdacht einer Straftat vorlag (vgl. Tz. 9.2).
Wenn eine derartig niedrige Quote von Missbrauchsfällen
ausreichen würde, um daraufhin alle Nutzer vorsorglich zu überwachen,
dann müssten z. B. alle Bundesautobahnen und Fernstraßen
komplett per Video und mithilfe anderer elektronischer Hilfsmittel
überwacht werden, denn die Dichte an Regelverstößen
bis hin zum strafbaren Verhalten ist dort sicherlich ganz erheblich
höher. Und niemand kann behaupten, Verkehrsverstöße
seien harmlos. Tausende von Toten und Verletzten Jahr für Jahr
auf den Straßen allein in Deutschland zeigen, dass die Nichtbeachtung
von Verkehrsregeln schnell ganz schlimme Folgen haben kann. Zurück zum Internet. Dass gerade dort die Überwachungsfantasien
üppiger sind als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, hat
wahrscheinlich Gründe, die tiefer liegen. Das Internet verkörpert
immer auch ein Stück Freiheit, insbesondere Gedanken- und Informationsfreiheit.
Für manche scheint der Gedanke an Bürger, die sich über
die Grenzen hinweg frei und unbeobachtet austauschen können,
etwas Unheimliches, Bedrohliches zu haben. Was werden die Bürger
ohne Kontrolle tun? Für Diktaturen ist diese Vorstellung offenbar
besonders schwer zu ertragen. Sie behindern den Zugang ihrer Bürger
zum Internet in unerträglicher Weise. China zum Beispiel hat
die Nutzung unseres Anonymisierungsdienstes AN.ON
unterbunden (vgl. Tz. 9.2). Zu
Recht hat der Bundeskanzler vor kurzem in Peking ein freies Internet
angemahnt. Wir sollten in Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen. |
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |