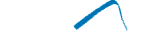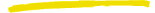Kernpunkte:
- Beanstandungen nach dem IZG-SH
- Top-5-Themen und besondere Fälle
- Beschlüsse der IFK
- Wünsche an den Gesetzgeber
12 Informationsfreiheit
2024 war ein arbeitsreiches Jahr für uns im Bereich der Informationsfreiheit. In vier Fällen haben wir Beanstandungen gegenüber öffentlichen Stellen in Schleswig-Holstein aussprechen müssen (Tz. 12.1). Die Zahl der Beschwerden von Antragstellern aufgrund ihrer Ansicht nach ungenügender Beachtung des IZG-SH durch öffentliche Stellen hat erneut merklich zugenommen. Waren es 2022 noch 37 und 2023 82 Eingaben, so erreichten uns 2024 sogar 128 Eingaben. Neben den Evergreens, die auch weiterhin einen Großteil der Beschwerden ausmachten (Tz. 12.2), waren auch wieder einige besondere Fälle dabei (Tz. 12.3).
Für eine bundesweite Vernetzung haben wir unsere Arbeit in der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten (IFK) und dem zugehörigen Arbeitskreis aktiv fortgesetzt (Tz. 12.4). In der anstehenden Evaluation des IZG-SH wollen wir sowohl unsere Erfahrungen aus der schleswig-holsteinischen Informationszugangspraxis als auch aus dem Austausch mit anderen Informationsfreiheitsbeauftragten aus Bund und Ländern als Wünsche an den Gesetzgeber einbringen (Tz. 12.5).
12.1 Beanstandungen
2022 hat der schleswig-holsteinische Gesetzgeber das IZG-SH geändert und damit auch die Befugnisse der/des Landesbeauftragten für Informationszugang erweitert (41. TB, Tz. 12.4; 42. TB, Tz. 12.1). § 14 Abs. 5 IZG-SH regelt, dass für solche Fälle, in denen die oder der Landesbeauftragte für Informationszugang Verstöße gegen das IZG-SH feststellt, sie oder er diese gegenüber der informationspflichtigen Stelle beanstanden kann. Hiervon haben wir im Berichtszeitraum viermal Gebrauch machen müssen. Im Vorfeld einer Beanstandung geben wir jeweils der betroffenen Stelle und anschließend auch der zuständigen Rechts-, Dienst- oder Fachaufsichtsbehörde Gelegenheit zur Stellungnahme.
1. Über die Beanstandung gegenüber der Apothekerkammer Schleswig-Holstein hatten wir schon im 42. TB, Tz. 12.1 berichtet.
2. Es wurde festgestellt, dass das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein den von einer Antragstellerin nach § 4 IZG-SH beantragten Informationszugang ohne nachvollziehbare Gründe an die Mitteilung identifizierender Informationen gebunden und damit gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 IZG-SH bzw. § 6 Abs. 1 Satz 3 IZG-SH verstoßen hat.
In diesem Fall beantragte die Antragstellerin nach dem IZG-SH beim Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Schleswig-Holstein Zugang zu bestimmten gespeicherten Daten, insbesondere bei der Landespolizei. Dafür bediente sie sich des Portals Fragdenstaat.de, das den Antrag in Form einer E‑Mail sendete. Den Antrag leitete das Ministerium an das Landeskriminalamt weiter, das auch zumindest teilweise die angefragten Informationen beauskunftete.
Allerdings ergaben sich bei der Antragstellerin noch Nachfragen. Das Landeskriminalamt wies darauf hin, dass für die Beantwortung erheblicher Aufwand entstehen und Kosten in Höhe von 200 Euro anfallen könnten. Die Antragstellerin sagte die Zahlung zu und bat um eine Möglichkeit, „die Kosten anonym“ begleichen zu können. Das Landeskriminalamt teilte der Antragstellerin mit, dass die Kosten „in Form eines ordentlichen, vollstreckbaren und klagefähigen Gebührenbescheids erhoben“ würden und dies nicht anonym möglich bzw. eine Anschrift erforderlich sei. Die Antragstellerin verwies aber darauf, dass nach Dokumenten auf der Website des ULD der Antrag bzw. die Bezahlung „auch anonym erfolgen“ können müsse, und zitierte hieraus, dass das IZG-SH nicht vorsehe, dass Name und Anschrift des Antragstellers mitgeteilt werden müssten. Nach Ansicht des Landeskriminalamts handelte es sich hingegen um einen klagefähigen Gebührenbescheid, der auf Grundlage des Verwaltungskostengesetzes erstellt werde – also um einen Verwaltungsakt. Verwaltungsakte unterlägen dem Bestimmtheitsgrundsatz. Hiernach müssten Verwaltungsakte u. a. zustellbar und vollstreckbar sein. Ein anonymer Gebührenbescheid sei weder zustellbar noch vollstreckbar und somit rechtswidrig. Insofern könne eine Bearbeitung der Anfrage erst dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen für die Erstellung eines rechtmäßigen Gebührenbescheides gegeben seien bzw. die Identität der Antragstellerin offengelegt werden würde.
Wir konnten die Argumentation des Landeskriminalamtes nicht nachvollziehen. Das IZG-SH sieht gerade keine Identifikationspflicht des Antragstellers bzw. der Antragstellerin vor. Eine anonyme Antragstellung ist grundsätzlich möglich und stellt keinen Ablehnungsgrund dar (siehe auch Tz. 12.5). Die Auskunft davon abhängig zu machen, dass die Antragstellerin Kontaktdaten bzw. konkrete Angaben zu ihrer Identität macht, ist dann nicht zulässig, wenn wie hier u. a. eine Vorausleistung möglich ist und angeboten wird. Bei Gebührenbescheiden muss im Einzelfall geprüft werden, ob diese so zugestellt werden können und ob Zahlungen möglich sind, ohne dass Antragsteller Namen nennen und sich identifizieren müssen. Eine Identifizierung der antragstellenden Person ist nicht erforderlich, solange sichergestellt werden kann, dass die informationspflichtige Stelle die begehrten Informationen der antragstellenden Person zukommen lassen kann und z. B. über anonyme Bezahlverfahren die eventuell entstehende Gebührenpflicht durchsetzbar ist.
Dies folgt aus dem Sinn und Zweck des IZG-SH als Recht für jeden Menschen zur Durchsetzung der Transparenz der Behörden. Es kommt hier gerade nicht auf die Person der Antragstellerin oder des Antragstellers an, da nicht Zielrichtung des Gesetzes ist, individuelle Rechte zu wahren, die in der Person der Antragstellerin oder des Antragstellers begründet sind. Das unterscheidet dieses Verfahren von vielen anderen Verwaltungsverfahren, in denen eine Antragstellerin bzw. ein Antragsteller etwas beantragt, um eigene Interessen zu wahren. Indem Transparenz der Behörde als ein eigener Wert gesehen wird, der von jeder Person eingefordert werden kann, ist es nicht erforderlich, dass sich diese identifiziert. Dass im Sinne der Ausführungen des Ministeriums nach Artikel 6 DSGVO bzw. § 3 Abs. 1 LDSG die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Behörden grundsätzlich zulässig ist, ändert nichts daran, dass für einzelne Verwaltungsvorgänge die Reduzierung der Kontaktdaten auf ein Minimum nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes auch aus Haushaltsinteressen zumutbar und damit geboten ist. Verwaltungsakte sind auch grundsätzlich formfrei. Ein Verwaltungsakt enthält zwar eine Regelung mit Bindungswirkung. Dem steht jedoch eine anonyme Antragstellung nicht entgegen, da es im Rahmen eines Anspruchs nach dem Informationszugangsgesetz gerade nicht auf die antragstellende Person und ihre Interessen ankommt.
3. Es wurde festgestellt, dass die Gemeinde Heikendorf, vertreten durch das Amt Schrevenborn, dem von mehreren Antragstellern nach § 4 IZG-SH beantragten Informationszugang nicht fristgerecht entsprochen und teilweise ohne nachvollziehbare Gründe abgelehnt und damit gegen § 3 Satz 1 IZG-SH i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 IZG-SH bzw. § 6 Abs. 1 Satz 3 IZG-SH verstoßen hat.
Mehrere Antragsteller hatten bei der Gemeinde Heikendorf Informationen über Gemeinderatssitzungen und Anwaltsgutachten im Auftrag der Gemeinde beantragt. Diese Auskünfte waren nur teilweise und mehrfach deutlich nach Ablauf der Monats- bzw. Zweimonatsfrist des IZG-SH erfolgt. Begründet wurde die Verweigerung von Informationen zu Gemeinderatssitzungen u. a. damit, dass die Gemeindeordnung (GO) den Regelungen des IZG-SH vorgehen würde und damit Informationen bezüglich nichtöffentlicher Sitzungen versagt werden könnten. Der Informationszugang sei insofern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 IZG-SH teilweise abgelehnt worden, da die Bekanntgabe der Informationen nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit der Beratungen in nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeinde Heikendorf gehabt hätte. Zudem hätten die entnommenen Sitzungsvorlagen der unmittelbaren Vorbereitung des gemeindlichen Entscheidungsprozesses gedient und fielen daher unter den Schutz des § 9 Abs. 2 Nr. 2 IZG-SH.
Hinsichtlich der Gutachten wurde auf § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 verwiesen, wonach die Vertraulichkeit der Beratungen von informationspflichtigen Stellen geschützt wird. Auch handele es sich um interne Mitteilungen im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 IZG-SH.
Beiden Argumentationen konnten wir nicht folgen. Die GO stellt kein Spezialrecht gegenüber dem IZG-SH dar, das diesem vorgehen würde. Dies ist ausdrücklich in § 16a Abs. 4 GO geregelt, wonach die Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner nach dem IZG-SH unberührt bleiben. Im Gegensatz zum Vorgänger des IZG-SH, dem Informationsfreiheitsgesetz Schleswig-Holstein (IFG), normiert § 3 Satz 2 IZG-SH keinen grundsätzlichen Vorrang anderer Gesetze. Die Rechte auf Zugang zu Informationen, die andere Gesetze einräumen, bleiben lediglich unberührt. Die Regelungen der GO werden durch das IZG-SH allerdings auch nicht ausgehebelt und sind natürlich in ihrem Sachzusammenhang zu beachten. Eine Sperrwirkung für die Informationen für sonstige Auskunftsrechte bzw. Informationsrechte in der Zukunft (etwa nach dem IZG-SH) ist dem jedoch nicht zu entnehmen. Das IZG-SH ist somit nicht grundsätzlich für Informationen gesperrt, die in einer nichtöffentlichen Gemeindesitzung Thema waren.
Gutachten unterfallen in der Regel nicht den Ausnahmen in § 9 IZG-SH. Nach Kommentaransicht und Rechtsprechung fallen die zur Entscheidung führenden Tatsachen, Sachinformationen und gutachterlichen Stellungnahmen nicht unter die in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IZG-SH geschützten Beratungen. Auch handelt es sich nicht um interne Mitteilungen nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 IZG-SH. Es kommt somit nicht darauf an, ob das Verfahren bezüglich der Sachverhalte, die die Gutachten betrafen, schon abgeschlossen ist. Zwar kann ein Gutachten Grundlage für die Willensbildung sein und damit auch Teil des Willensbildungsprozesses. Allerdings unterliegt es nicht selbst der Willensbildung, sondern stellt nur eine feststehende Grundlage dar, die wie auch andere Tatsachen von den Beratungsorganen bewertet werden muss. Ein Gutachten nimmt auch keine Beratung vorweg, sondern muss individuell betrachtet werden. Der Inhalt des Gutachtens wird nicht abgewogen, sondern die Abwägung erfolgt im hierauf aufbauenden Beratungsvorgang.
Die Gemeinde Heikendorf bzw. das Amt Schrevenborn haben gegen unsere Beanstandung Klage beim Verwaltungsgericht in Schleswig eingelegt. Das Verfahren ist somit noch nicht abgeschlossen und wird uns weiter beschäftigen.
4. Es wurde festgestellt, dass das Amt Schwarzenbek-Land einem nach § 4 IZG-SH beantragten Informationszugang nicht fristgerecht entsprochen und damit gegen § 3 Satz 1 IZG-SH i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 IZG-SH verstoßen hat.
Der Antragsteller hatte im September 2023 Akteneinsicht in ein bestimmtes Verfahren beantragt. Im Folgenden kam es zu mehrfachen Versuchen vonseiten des Antragstellers, für die Akteneinsicht einen Termin zu vereinbaren. Auf diese Schreiben wurde mehrfach sehr zögerlich reagiert und mehrfach darauf verwiesen, dass eine zu dem Zeitpunkt abwesende Person, die für den Fall zuständig sei, sich nach ihrer Rückkehr beim Antragsteller melden würde. Ende Oktober 2023 erreichte uns die Beschwerde des Antragstellers, und auch wir bemühten uns, bei der informationspflichtigen Stelle eine Auskunft oder zumindest einen abschließenden Bescheid zu erreichen. Doch auch hierauf wurde selbst nach bewilligter Fristverlängerung nicht zielführend reagiert. Im weiteren Verlauf kam es zwar tatsächlich zu Terminabsprachen zwischen dem Amt und dem Antragsteller für eine Akteneinsicht. Aber auch diese Termine wurden dann wieder vom Amt kurzfristig abgesagt – mit Ausnahme einer ersten Einsichtnahme im Januar 2024. Schließlich erfolgte erst im August 2024 eine Teilauskunft. Weitere Unterlagen wurden zwar in Aussicht gestellt, doch auch die Terminabsprache hierzu wurde nur sehr zögerlich bearbeitet.
Nach § 5 Abs. 2 IZG-SH besteht eine Frist von einem Monat, auf einen entsprechenden Antrag zu antworten. Bei umfangreichen und komplexen Sachverhalten kann diese Frist auf zwei Monate erweitert werden, worüber der Antragsteller zu informieren ist. Auch wenn zwischenzeitlich eine Teilauskunft durch die informationspflichtige Stelle getätigt wurde, so wurde nach den uns vorliegenden Informationen auch von dieser nicht bestritten, dass die Auskunftserteilung noch nicht vollständig war. Auch ist nicht ersichtlich, dass vonseiten des Antragstellers noch eine Konkretisierung des Antrags vom Amt erwartet worden wäre. Selbst wenn die Nachfragen des Antragstellers bei der ersten Einsichtnahme im Januar 2024 als neuer Antrag nach dem IZG-SH angesehen werden würden, wäre die Monatsfrist inzwischen deutlich überschritten.
Die Absagen der Termine erfolgten in den meisten Fällen aus Gründen der Abwesenheit der zuständigen Person. Das IZG-SH sieht keine Verlängerungen der Fristen nach § 5 Abs. 2 IZG-SH vor, sodass die Behörde selbst in der Pflicht ist, organisatorische Vorkehrungen zu treffen, die Fristen einzuhalten. Selbst wenn solche besonderen Umstände gegebenenfalls Augenmaß bei dem weiteren Vorgehen verlangen, waren hier kaum Maßnahmen der Behörde erkennbar, die Situation zugunsten des Antragstellers zu klären.
Erschwerend kam hinzu, dass mehrfach neue Termine angekündigt wurden, die dann wieder abgesagt wurden, und zwischen März und August 2024 keine Reaktion mehr gegenüber dem Antragsteller und auch uns erfolgte. Auch danach reagierte das Amt zunächst nicht auf Versuche des Antragstellers für eine Terminfindung zur mittlerweile von der Behörde angebotenen Akteneinsicht. Das Verfahren befindet sich inzwischen in einer gerichtlichen Klärung.
Was ist zu tun?
Das Mittel der Beanstandung ist bei Verstößen gegen das IZG-SH weiterhin zu nutzen, um den informationspflichtigen Stellen nachdrücklich offenzulegen, wenn sie bei der Umsetzung der Informationsfreiheit Fehler machen.
12.2 Top 5 der Themen in Schleswig-Holstein
Nach § 14 Abs. 1 IZG-SH kann eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden ist oder dass sie von einer informationspflichtigen Stelle eine unzulängliche Antwort erhalten hat, die Landesbeauftragte für Informationszugang anrufen. Einige Beschwerdegründe von Petentinnen und Petenten wiederholten sich auch 2024 mehrfach. Die Top 5 der Beschwerden unterscheiden sich kaum von denen der letzten Jahre (vgl. u. a. 41. TB, Tz. 12.3 und 42. TB, Tz. 12.2). Hinzugekommen ist jedoch noch eine besondere Beobachtung unsererseits.
Der häufigste Beschwerdegrund war erneut, dass die informationspflichtige Stelle nicht fristgerecht auf den Antrag auf Informationszugang reagierte. Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 IZG-SH sind die Informationen der antragstellenden Person unter Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebenen Zeitpunkte sobald wie möglich, spätestens jedoch mit Ablauf eines Monats nach Eingang des Antrags zugänglich zu machen. Nur bei umfangreichen und komplexen Anfragen kann die Frist auf höchstens zwei Monate verlängert werden (§ 5 Abs. 2 Satz 2 IZG-SH). Die Verlängerung ist zu begründen und schon innerhalb des ersten Monats mitzuteilen. Zu beachten ist, dass die Rückmeldung sobald wie möglich erfolgen muss und die Monatsfrist nicht zwingend ausgeschöpft werden sollte. Die Frist beginnt mit Eingang des Antrags und ist grundsätzlich unabhängig von der personellen und organisatorischen Ausgestaltung der informationspflichtigen Stelle (vgl. auch Tz. 12.1 Nr. 4). Auch eine teilweise oder vollständige Ablehnung muss die Fristen einhalten. Eine Sondersituation besteht, wenn der Antrag zu unbestimmt war und noch von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller präzisiert werden muss. Dann muss die Aufforderung zur Präzisierung auch innerhalb eines Monats erfolgen. Nach Eingang des präzisierten Antrags beginnt die Frist zur Beantwortung des Antrags erneut (§ 4 Abs. 2 IZG-SH).
Nicht immer ist erkennbar, ob die ausstehende Antwort nach Ablauf der Frist darauf beruhte, dass die konkrete Fristenregelung ignoriert wurde oder gar nicht erkannt worden ist, dass es sich um einen Antrag nach dem IZG-SH handelte. Das Gesetz schreibt keine besondere Form für den Antrag vor. Auch müssen sich antragstellende Personen nicht konkret auf das IZG-SH berufen. Grundsätzlich kann somit jeder Wunsch nach Informationen bei einer öffentlichen Stelle als Antrag im Sinne des § 4 Abs. 1 IZG-SH gewertet werden. Dies kann auch für mündliche Anträge etwa in Bürgersprechstunden gelten. Bei Unklarheit über den Charakter der Anfrage sollte umgehend nachgefragt bzw. gegebenenfalls um Präzisierung des Antrags gebeten werden.
Nicht immer wird bei (Teil-)Ablehnungen die Form des § 6 IZG-SH eingehalten. Der antragstellenden Person sind danach stets die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen, auch wenn sie nur einige wenige Schwärzungen betreffen. Auch ist über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Entscheidung sowie darüber, bei welcher Stelle und innerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden kann, zu belehren.
Es hat sich in vielen Fällen gezeigt, dass die Beschwerden eventuell hätten vermieden werden können, wenn die informationspflichtige Stelle frühzeitig den Kontakt zu dem Antragsteller bzw. der Antragstellerin aufgenommen hätte, um Unklarheiten zu beseitigen und Verständnis für gegebenenfalls bestehende Auskunftsprobleme zu wecken. Gerade auch mit Blick auf den Aufwand bei der Behörde (und damit einhergehend gegebenenfalls die anfallenden Kosten) kann es sinnvoll sein, ins Gespräch zu kommen. Wenn stattdessen die Angelegenheit bis zur Beschwerde liegen gelassen wird, erzeugt das das unangenehme Gefühl bei Antragstellerinnen und Antragstellern, dass die Behörde Anfragen bewusst ignoriert. Bis zur gerichtlichen Auseinandersetzung ist es dann nicht weit. In § 4 Abs. 2 Satz 4 IZG-SH ist ausdrücklich geregelt, dass die informationspflichtige Stelle die antragstellende Person bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen zu unterstützen hat. Eine Chance, die zu beiderseitigem Vorteil leider nicht immer genutzt wird.
Eine weitere oft ungenutzte Chance ist, dass die informationspflichtigen Stellen auch uns um Rat bitten können. Nach § 14 Abs. 3 IZG-SH berät die oder der Landesbeauftragte für Informationszugang die informationspflichtigen Stellen in Fragen zum IZG-SH. Im Berichtszeitraum ist es jedoch erneut vorgekommen, dass informationspflichtige Stellen, nachdem wir sie aufgrund einer Beschwerde um Stellungnahme gebeten haben, die Angelegenheit an eine Kanzlei abgaben. Dies ist zwar nicht per se zu kritisieren, jedoch haben wir in einigen Fällen den Eindruck gehabt, dass es sinnvoll gewesen wäre, vorab auch den Kontakt zu uns aufzunehmen. Insbesondere in Fällen, in denen die Behörde von uns angeschrieben wurde, da sie zunächst gar nicht auf einen Antrag nach dem IZG-SH reagiert hatte, könnte zunächst geklärt werden, ob tatsächlich ein rechtlicher Dissens der Ansichten vorliegt.
Die Grundlagen zum IZG-SH haben wir in einer Broschüre zusammengefasst, die regelmäßig aktualisiert wird:
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/
praxisreihe/Praxisreihe-7-Informationszugang.pdf
Kurzlink: https://uldsh.de/tb43-12-2a
Was ist zu tun?
Wir gehen den Beschwerden von Petentinnen und Petenten nach und weisen informationspflichtige Stellen gegebenenfalls auf Fehler bei der Bearbeitung von Informationszugangsersuchen hin. Damit Fehler gar nicht erst auftreten, werden wir die Schulung bzw. Information über das IZG-SH gegenüber öffentlichen Stellen intensivieren.
12.3 Besondere Fälle und Fragen
Im Berichtszeitraum hatten wir einige besondere Anfragen und Beschwerden, die über die typischen Fragestellungen (Tz. 12.2) hinausgingen.
Auch wenn immer mal wieder juristische Personen des Privatrechts bestreiten, dass sie nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 IZG-SH dem IZG-SH unterfallen, und zu keiner Auskunft bereit sind, gab es im Berichtszeitraum ein Positivbeispiel: Einige Rettungshubschrauber werden durch die DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG in Filderstadt betrieben. Ein Petent hatte dort Informationen zu Einsätzen von Rettungshubschraubern nach dem IZG-SH beantragt. Eine Antwort hatte er jedoch nicht erhalten. Wir wiesen die Stelle darauf hin, dass sie für die Aufgabe beliehen wurde und somit Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts übertragen bekommen habe. Nach kurzer Diskussion über mögliche Ausnahmegründe kam die Stelle ihren Pflichten nach dem IZG-SH nach.
Soweit natürliche oder juristische Personen des Privatrechts nicht beliehen wurden und daher auf den ersten Blick nicht dem IZG-SH unterfallen, kann dieses bei Umweltinformationen anders zu beurteilen sein. So hatten wir im 42. TB, Tz. 12.3 von Stadtwerken berichtet, die nicht dem IZG-SH unterfielen. In einem anderen Kontext wurde nach Intervention durch uns anerkannt, dass Informationen herauszugeben waren. Dies gilt nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 IZG-SH bei Umweltinformationen, soweit die natürliche oder juristische Person des Privatrechts im Zusammenhang mit der Umwelt öffentliche Aufgaben wahrnimmt und dabei der Kontrolle des Landes oder einer unter Aufsicht des Landes stehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts unterliegt. Kurz gesagt, bei Umweltinformationen reicht es in der Regel aus, dass die juristische Person des Privatrechts von einer öffentlichen Stelle kontrolliert wird. Eine Beleihung ist nicht erforderlich. Ausführlich diskutiert wurde im konkreten Fall dann jedoch, welche Informationen tatsächlich „Umweltinformationen“ seien.
Mehrfach beschäftigten uns Anfragen von Antragstellern nach Datenschutz-Folgenabschätzungen (Artikel 35 DSGVO) und Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 30 DSGVO) bei informationspflichtigen Stellen. Diese Anfragen wurden teilweise sehr pauschal von den informationspflichtigen Stellen abgelehnt. Wir teilten den Stellen daher daraufhin mit, dass auch diese Dokumente grundsätzlich informationspflichtig sind. Insbesondere spielt es in Bezug auf das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten keine Rolle, dass im Gegensatz zum alten Verfahrensverzeichnis aus dem BDSG oder LDSG die DSGVO keine Veröffentlichung dieses Verzeichnisses verlangt. Dass darin keine Veröffentlichungspflicht explizit geregelt wird, bedeutet nämlich keinen Ausschluss der Anwendbarkeit des IZG-SH. Auch war für die DSGVO ein anderer Gesetzgeber zuständig, sodass es sich in Artikel 30 DSGVO nicht um eine Nachfolgeregelung vom BDSG handelt. Somit sind beide Dokumente – das Verzeichnis nach Artikel 30 DSGVO sowie der Bericht der Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35 DSGVO – grundsätzlich zunächst einmal auskunftspflichtig. Geprüft werden muss jedoch, ob Ausnahmevorschriften nach §§ 9 und 10 IZG-SH greifen. Bei der Datenschutz-Folgenabschätzung kann dieses insbesondere bedeutende Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IZG-SH betreffen: Die Herausgabe von zugehörigen Dokumenten darf nicht zu Sicherheitsproblemen führen. Dabei ist jedoch zusätzlich neben der entsprechenden Abwägung auch zu untersuchen, ob zumindest Teile des Berichts der Datenschutz-Folgenabschätzung beauskunftet werden können.
In der Regel fragen Antragstellerinnen und Antragsteller Informationen an, die schriftlich bzw. in Textform bei einer Stelle vorhanden sind. Außergewöhnlich war eine Beschwerde, bei der ein Petent den Tonmitschnitt einer öffentlichen Ratsversammlung anfragte. Tatsächlich sind nach § 1 Abs. 1 IZG-SH Informationen im Sinne des IZG-SH alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder auf sonstigen Informationsträgern vorhandene Zahlen, Daten, Fakten, Erkenntnisse oder sonstige Auskünfte. Der Tonmitschnitt fiel also darunter. Allerdings waren hierauf auch die Stimmen anderer Personen zu hören, sodass der Schutz personenbezogener Daten im Sinne des § 10 Satz 1 Nr. 1 IZG-SH geprüft werden musste. Bei der Abwägung musste zwischen unbeteiligten Dritten und Teilen der Ratsversammlung unterschieden werden. Im Endeffekt einigte man sich darauf, dass das Tonprotokoll zwar nicht übermittelt wurde, jedoch angehört werden konnte.
Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, inwieweit Wahlorgane vom IZG-SH erfasst sind. Ein Petent beantragte Wahlniederschriften zur Europawahl 2024 bzw. Informationen zu ungültig erklärten Wahlscheinen. Die Stelle führte jedoch aus, dass das IZG-SH nicht auf die Wahlorgane anwendbar sei, da keine Behördenfunktion gegeben sei. Die Wahlorgane seien als eine Art Selbstverwaltungsorgane der Wahlberechtigten ausgestaltet. Ein Ausschluss von Wahlorganen ist dem IZG-SH jedoch unseres Erachtens nicht zu entnehmen. Anwendbar ist das IZG-SH nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 IZG-SH nicht nur für Behörden, sondern auch für sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts.
Wir vertreten die Ansicht, dass es sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl um Verwaltungshandeln handelt. Für den Bundeswahlleiter wird dieses ausdrücklich in der Kommentarliteratur mit Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG Bund) bejaht. Dies hat der Bundeswahlleiter auch anerkannt. Wir können nicht erkennen, weshalb für die hier infrage stehende Wahl für Schleswig-Holstein etwas anderes gelten sollte. Es liegt im Interesse der Gesellschaft, dass Wahlen transparent durchgeführt werden, weshalb es unseres Erachtens widersinnig wäre, wenn ein Gesetz zur Förderung der transparenten Verwaltung hierauf keine Anwendung finden würde. Einwänden, wie etwa dem Personenbezug einiger der gewünschten Informationen, kann mit den Ausschlussgründen der §§ 9 und 10 IZG-SH begegnet werden. Sie würden somit nicht dazu führen, dass das Wahlgeheimnis in Mitleidenschaft gezogen werden würde.
Unklar war in einem Fall, ob Vergabekammern dem IZG-SH unterliegen. Wörtlich ausgenommen sind sie nicht. In einem Beschwerdeverfahren wurde jedoch von einer Stelle ausgeführt, dass das Fehlen der Vergabekammern in den ausgenommenen Stellen nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH eine planungswidrige Regelungslücke darstellen würde. Vergabekammern seien Sonderbehörden mit gerichtsähnlicher Stellung, was wenig bekannt sei. Sie gewährten nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Primärrechtsschutz erster Instanz. Der Charakter der Vergabekammer als Gericht ist unseres Erachtens nicht eindeutig geregelt, da sie grundsätzlich Verwaltungsbehörden sind und damit Teil der Exekutive. Allerdings können auch Teile der Exekutive Organe der Rechtspflege sein.
Im Rahmen der Vorlagemöglichkeit von Gerichten beim EuGH nach Artikel 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat der EuGH auch die Vorlage einer Vergabekammer als Gericht anerkannt (EuGH, Urteil vom 18.09.2014 – C-549/13). Nach § 168 Abs. 3 GWB hingegen ergeht die Entscheidung der Vergabekammer durch Verwaltungsakt (und somit nicht durch ein Urteil). Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich in seinem Beschluss vom 15.12.2020 – 10 C 24.19 – auch zu dem Verhältnis Vergaberecht und Informationsfreiheit (hier: IFG Bund) geäußert und festgestellt, dass die Informationsfreiheit zumindest nach Abschluss des Vergabeverfahrens nicht durch die Vorschriften der Vergabeverordnung verdrängt wird.
Auch schließt § 165 GWB unseres Erachtens das IZG-SH nicht aus. Eine Subsidiaritätsklausel besteht gerade nicht im IZG-SH. Hinsichtlich laufender Verfahren kann die oben genannte Frage in vielen Fällen allerdings gegebenenfalls dahinstehen, da hierbei oftmals Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 10 Satz 1 Nr. 3 IZG-SH betroffen sein könnten und insbesondere vor einer Entscheidung der Vergabekammer noch die Vertraulichkeit der Beratungen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IZG-SH) vorliegen könnte.
Was ist zu tun?
Personen, die der Ansicht sind, dass ihre Anträge nach dem IZG-SH nicht ordnungsgemäß beantwortet worden seien, können sich an uns wenden. Zu unserer Aufgabe gehört es, die informationspflichtigen Stellen auf ihre Pflichten nach dem Gesetz hinzuweisen – wenn erforderlich auch in Form einer Beanstandung.
12.4 Beschlüsse der IFK
Im Rahmen des Arbeitskreises Informationsfreiheit (AKIF) und der Treffen der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK) in Dresden und Leipzig unter dem Vorsitz der Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftragten haben wir an mehreren Entschließungen maßgeblich mitgewirkt.
- Entschließung zwischen der 45. und der 46. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland vom 4. Juni 2024 in Dresden: Gut informiert im Superwahljahr 2024!
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/ifk/20240604_IFK_Entschliessung_Superwahljahr.pdf
Kurzlink: https://uldsh.de/tb43-12-4a - Entschließung der 46. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland am 05.06.2024 in Dresden: Pflicht zur Informationsfreiheit und Transparenz auch für Kommunen in Hessen und Sachsen!
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/ifk/Entschliessung_Kommunen.pdf
Kurzlink: https://uldsh.de/tb43-12-4b - Entschließung der 46. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland am 05.06.2024 in Dresden: Gleicher Auftrag – gleicher Informationsanspruch gegenüber öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten!
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/ifk/Entschliessung_Rundfunkanstalten.pdf
Kurzlink: https://uldsh.de/tb43-12-4c
Die Protokolle und weitere Informationen zu den Sitzungen der IFK können hier abgerufen werden:
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1347-.html
Kurzlink: https://uldsh.de/tb43-12-4d
Was ist zu tun?
Wir werden uns weiterhin intensiv in die Diskussionen und Entschließungen der IFK und des zugehörigen Arbeitskreises einbringen.
12.5 Wünsche an den Gesetzgeber
Nach § 14 IZG-SH kann eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden ist oder dass sie von einer informationspflichtigen Stelle eine unzulängliche Antwort erhalten hat, die Landesbeauftragte für Informationszugang anrufen. Dies wurde 128-mal im Berichtszeitraum gemacht. Hierbei und auch schon bei Beschwerden in den Jahren zuvor zeigten sich einige Unklarheiten im IZG-SH, die zu Diskussionen führten. Im Rahmen einer Weiterentwicklung des Gesetzes (Tz. 1.4) wünschen wir uns einige Klarstellungen.
- Ausweitung auf juristische Personen des Privatrechts, die im Besitz von öffentlichen Stellen sind
Hierzu hatten wir schon im letzten Tätigkeitsbericht Ausführungen gemacht (42. TB, Tz. 12.3). In der Praxis waren es Stadtwerke, die als GmbH ausgestaltet und 100 Prozent Töchter der jeweiligen Stadt sind und sich weigerten, Auskünfte nach dem IZG-SH zu tätigen. Nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 IZG-SH können auch derartige juristische Personen informationspflichtige Stellen sein, soweit ihnen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in den Handelsformen des öffentlichen Rechts übertragen wurden (sogenannte Beleihung). Als Beispiele nennt das Gesetz u. a. Energieerzeugung und -versorgung. Eine solche Beleihung ist jedoch selten und liegt nur in wenigen Fällen bei Unternehmen vor, die vollständig oder überwiegend in der Hand einer Kommune sind, obwohl diese etwa mit staatlichen Kontrahierungszwängen usw. begünstigt sind. Für Bürgerinnen und Bürger ist es kaum nachvollziehbar, weshalb diese Stellen aus der Informationsfreiheit herausgenommen wurden.
In einigen anderen Bundesländern unterliegen solche Unternehmen eindeutig der Auskunftspflicht; es ist dort nicht möglich, sich etwa durch Ausgründungen dieser Pflicht zu entziehen. So stellt etwa das Landesinformationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg in § 2 Abs. 4 darauf ab, ob eine öffentliche Stelle die Mehrheit am Kapital oder der Anteile an dem Unternehmen hält bzw. mehr als die Hälfte der entscheidenden Personen stellt. Eine solche Regelung wünschen wir uns auch. - Wann ist zu umfangreich zu unbestimmt?
Das IZG-SH macht bewusst kaum Vorgaben für die Ausgestaltung von Anträgen nach § 4 IZG-SH. Die Hemmschwelle soll gering gehalten werden und das Recht auf Informationszugang jeder Person offenstehen. Wenn der Antrag zu unbestimmt ist, so muss die informationspflichtige Stelle nach § 4 Abs. 2 IZG-SH zur Präzisierung auffordern. In der Praxis kommt es teilweise zu sehr umfangreichen Anfragen. Um dem ausufernden Umfang Herr zu werden, wird auch hier um Präzisierung gebeten und der Antrag als zu unbestimmt angesehen. Die Frage in der Praxis ist jedoch, wann eine informationspflichtige Stelle die vollständige Bearbeitung zunächst ablehnen kann, weil der damit verbundene Umfang zu groß ist. Dabei ist teilweise nicht nur der Umfang der betroffenen Informationen problematisch, sondern es werden auch Fragenkataloge mit dutzenden Einzelposten übermittelt und zu einem Antrag zusammengefasst.
In der Beratungspraxis bemühen wir uns in solchen Fällen insbesondere darum, die Parteien dazu zu bringen, sich persönlich zu dem Antrag auszutauschen. Dies ist auch schon im Gesetz in § 4 Abs. 2 Satz 4 IZG-SH angelegt, wonach die informationspflichtige Stelle bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen unterstützen muss. Ab wann eine solche Präzisierung geboten ist, ist dennoch weiterhin im Gesetz unklar. Hierbei kann man sich an der Kostenverordnung zum IZG-SH orientieren. Diese sieht für eine außergewöhnlich umfassende Auskunft eine maximale Gebühr in Höhe von 500 Euro (seit 14.01.2025 700 Euro) vor. Bei der Stufe darunter (umfassende Auskunft) ist eine Gebühr von maximal 250 Euro vorgesehen (seit 14.01.2025 350 Euro). Die Gebühren sind zwar nach § 13 Abs. 2 IZG-SH auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands so zu bemessen, dass das Recht auf Zugang zu Informationen wirksam in Anspruch genommen werden kann. Allerdings kann die Kostenverordnung auch einen Orientierungsrahmen zum möglichen Aufwand darstellen. Überschreitet die Anfrage der Petentin oder des Petenten diesen Umfang deutlich, kann gegebenenfalls der Antrag als zu unbestimmt angesehen werden. Dies sollte der Gesetzgeber zur Transparenz klarstellen. - Anträge unter Pseudonym
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.03.2024 – 6 C 8.22 – gegen den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, wonach nach dem IFG des Bundes anonyme Antragstellung oder Anträge unter einem Pseudonym unzulässig sein können, hat auch bei informationspflichtigen Stellen in Schleswig-Holstein für Irritationen gesorgt. Wir vertreten weiterhin die Ansicht, dass auch anonyme bzw. pseudonyme Anträge zulässig sind, und sehen keine Anzeichen im IZG-SH, die dieser Ansicht widersprechen würden. Bei der Betrachtung des Urteils ist zu beachten, dass es sich auf das IFG des Bundes bezieht und durchaus Abweichungen zu den Regelungen in Schleswig-Holstein bestehen. So nimmt etwa § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG Bund direkten Bezug auf die Antragstellerin oder den Antragsteller, was in § 10 Satz 1 Nr. 1 IZG-SH nicht der Fall ist. Auch nimmt das BVerwG Bezug auf die Gesetzesbegründung des IFG Bund, was natürlich nicht für das IZG-SH gelten kann. Hätte der Gesetzgeber in Schleswig-Holstein eine zwingende Identifizierung der Antragstellerin oder des Antragstellers gewollt, so hätte er es spätestens beim Erlass des IZG-SH als Nachfolger des IFG-SH aufnehmen können. Dies ist jedoch gerade nicht passiert. Ein Großteil der Anfragen nach dem IZG-SH erfolgt über Portale, die keinen Nachweis der Identität der Antragstellerin oder des Antragstellers verlangen und in der Regel problemlos bearbeitet werden können.
Das IZG-SH hat auch gerade keine Einschränkungen bezüglich der Antragstellenden vorgenommen (es ist z. B. nicht auf Bürgerinnen und Bürger aus Schleswig-Holstein beschränkt). Für die Gebührendurchsetzung mag es Gründe zur Identifizierung der Antragstellerin oder des Antragstellers geben (Tz. 12.1). Eine pauschale Pflicht zur Identifizierung sehen wir jedoch weder im IZG-SH verankert noch als zweckmäßig an. Um hierzu Klarheit für Antragstellende und informationspflichtige Stellen zu erhalten, sollte dies auch im Gesetz herausgestellt werden. - Transparenzbeauftragte
Es zeigt sich, dass in vielen informationspflichtigen Stellen unklar ist, wer für Anfragen nach dem IZG-SH zuständig ist und auch für uns als Ansprechpartner genutzt werden kann. Teilweise werden die Datenschutzbeauftragten zusätzlich mit dieser Aufgabe betreut, teilweise ist es Chefsache und teilweise gibt es gar keine Regelungen. Daher halten wir es für sinnvoll, dass informationspflichtige Stellen eine(n) Beauftragte(n) für Informationszugang bzw. Transparenz benennen. Auch wenn die Informationen an sehr unterschiedlichen Stellen einer Behörde vorliegen können, so erscheint es sinnvoll, eine zentrale Koordinierungsstelle zu haben, die als Ansprechpartnerin für Antragstellende und für uns fungiert. Auch kann eine solche Koordinierungsstelle bei Landesbehörden dafür Sorge tragen, dass die Veröffentlichungspflichten nach § 11 IZG-SH eingehalten werden. Auch wenn wir keine Pflicht zur Benennung einer oder eines behördlichen Beauftragten für Informationszugang bzw. Transparenz vorschlagen wollen, hielten wir es für förderlich, eine Anregung zur freiwilligen Benennung für eine solche Position ins Gesetz aufzunehmen.
Was ist zu tun?
Wir bringen unsere Praxiserfahrungen mit der Umsetzung des IZG-SH in der Diskussion zur Gesetzesevaluierung ein und bieten unsere Unterstützung bei Gesetzesänderungen an.
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |