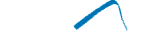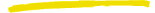4.7 Bildung
4.7.1 Ärztliche Bescheinigung zum Nachweis der Prüfungsunfähigkeit
Das ULD war mit der Frage befasst, welche Anforderungen die Hochschulen an den Nachweis der Prüfungsunfähigkeit bei der Studentenschaft stellen dürfen. So wird in Prüfungsordnungen der Hochschulen geregelt, dass in den Fällen eines Rücktritts vom Prüftermin oder beim Versäumen des Prüftermins die Prüfung als nicht ausreichend bewertet wird, es sei denn, es liegen besondere, von der oder dem Studierenden nicht zu vertretende Gründe vor. Ein solcher Grund kann darin bestehen, dass der Prüfungstermin krankheitsbedingt nicht wahrgenommen werden konnte. Diese krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit ist wiederum durch ein ärztliches Attest unter Angabe der voraussichtlichen Dauer der Prüfungsunfähigkeit glaubhaft darzulegen.
Auszug aus der Prüfungsordnung einer Hochschule
Tritt eine Kandidatin oder ein Kandidat von ihrer oder seiner Modulprüfung nach Frist der Anmeldung oder nach Beginn der Prüfung zurück oder versäumt sie oder er den Termin der Prüfung, so gilt diese als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet, es sei denn, es liegt ein triftiger und nicht von der bzw. dem Studierenden zu vertretender Grund vor [...]. Bei Rücktritt oder Versäumnis wegen Krankheit am Prüfungstag ist unverzüglich ein ärztliches Attest unter Angabe der voraussichtlichen Dauer der Prüfungsunfähigkeit [...] vorzulegen [...]. Bei lang andauernder und wiederholter Krankheit kann der zuständige Prüfungsausschuss die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen.
Die Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren hierzu Stellung genommen. Demnach gilt:
- Nicht die Ärztin oder der Arzt, sondern das zuständige Prüfungsamt bzw. ein Prüfungsausschuss entscheidet darüber, ob die nachgewiesenen Gründe einen Rücktritt von der Prüfung rechtfertigen, also ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt.
- Die in einem ärztlichen Attest enthaltene Einschätzung, dass Prüfungsunfähigkeit bestehe, bildet nur ein Indiz für das Vorliegen von Prüfungsunfähigkeit.
- Die ärztliche Verpflichtung beschränkt sich darauf, krankhafte Beeinträchtigungen zu beschreiben und darzulegen, welche Auswirkungen diese auf das Leistungsvermögen des Prüflings in der konkret abzulegenden Prüfung haben.
- Die von Hochschulen erbetene Angabe von Befundtatsachen hat die Rechtsprechung nicht beanstandet. Diese beziehen sich auf Krankheitssymptome, die zu einer Verringerung der Leistungsfähigkeit führen können.
Der Nachweis der Prüfungsunfähigkeit ist nach Einschätzung des ULD von einer Bescheinigung über das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit zu unterscheiden. Letzteres wird in § 5 Abs. 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EnzFG) geregelt, wonach der Umstand der Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer dem Arbeitgeber mitzuteilen sind. Vorliegend handelt es sich aber um eine Glaubhaftmachung der Prüfungsunfähigkeit, wobei zusätzlich eine Mitteilung von Befundtatsachen geboten sein kann.
Aus Sicht des ULD ist jedoch für die Hochschulen eine Kenntnis der ärztlichen Diagnose nicht erforderlich. Maßgebend sind nur Angaben zu den durch die Krankheit hervorgerufenen physischen und psychischen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Hinzu kommt, dass die Hochschulen für die Verarbeitung entsprechend sensibler Gesundheitsdaten eine hinreichende gesetzliche Ermächtigung brauchten, etwa im Hochschulgesetz, um im Rahmen des Erlasses eigener Satzungen und Prüfungsordnungen derartige Regelungen treffen zu dürfen. Weiterhin kommt das ULD zu der Einschätzung, dass die Hochschulen die Diagnosedaten nicht auf Grundlage einer Einwilligung des Prüflings bzw. einer Schweigepflichtentbindungserklärung der Ärztin oder des Arztes fordern dürfen, da sich der zulässige Datensatz auf die Befundtatsachen beschränkt. Die Einwilligung kann aber auch nicht auf die Bereitstellung der Angaben zu den Befundtatsachen gestützt werden, wenn bezüglich dieser Daten eine hinreichende rechtliche Grundlage in einer Prüfungsordnung der Hochschule vorhanden ist. Anderenfalls entstünde bei den Prüflingen der Eindruck, dass die Erklärung der Einwilligung freiwillig ist, deren Nichterklärung keine Konsequenzen hat und die Erklärung frei widerruflich ist. Einwilligungen bedürften zu ihrer Wirksamkeit gerade der beschriebenen Wahlfreiheit ohne negative Folgen und eine Belehrung zur jederzeitigen Widerruflichkeit. Besteht aber eine Rechtsgrundlage für die Erhebung der Befundtatsachen, wäre die Verwendung eines Einwilligungsformulars irreführend.
Was ist zu tun?
Die Hochschulen müssen prüfen, ob die Erhebung der Befundtatsachen im internen Hochschulrecht, insbesondere in maßgeblichen Prüfungsordnungen, normiert ist. Besteht eine entsprechende Legitimation, ist die Einholung einer Einwilligung zur Mitteilung von Befundtatsachen entbehrlich. Diagnosedaten dürfen die Hochschulen nicht erheben, um eine Prüfungsunfähigkeit zu untersuchen. Weiterhin müssen die Hochschulen prüfen, ob generell für die Erhebung von Gesundheitsdaten von Prüflingen zum Nachweis der Prüfungsunfähigkeit eine ausreichende gesetzliche Ermächtigung besteht, um Näheres im internen Hochschulrecht, etwa in einer Prüfungsordnung, zu regeln.
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |