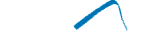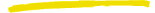Kernpunkte:
- Beanstandungen nach dem IZG-SH
- Entschließungen der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten
- Informationsfreiheit by Design
12 Informationsfreiheit
Im Jahr 2022 hatten wir den Vorsitz über die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten (IFK) wahrgenommen (41. TB, Tz. 1.4 und Tz. 12.1) und in der Funktion die Themen rund um Transparenz und Informationszugang vorangetrieben. Doch auch ohne Vorsitzrolle war uns dies ein Anliegen, wie im Berichtsjahr zu sehen. So machten wir nach der Gesetzesänderung 2022 beispielsweise von dem neu eingeführten Beanstandungsrecht von § 14 Abs. 5 Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein (IZG-SH) Gebrauch (Tz. 12.1). Die Zahl der Beschwerden von Antragstellern wegen ihrer Ansicht nach ungenügender Beachtung des IZG-SH durch öffentliche Stellen zog merklich an. Waren es 2022 noch 37 Fälle, mussten wir 2023 82 Eingaben registrieren. Neben den Evergreens, die auch weiterhin einen Großteil der Beschwerden ausmachten (Tz. 12.2), waren auch einige besondere Fälle dabei (Tz. 12.3).
2023 haben wir zudem an den Sitzungen der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten aktiv mitgewirkt und den zugehörigen Arbeitskreis besucht (Tz. 12.4). Maßgeblich waren wir dabei insbesondere in den Feldern aktiv, die sich auf die praktische Umsetzung des Informationszugangs beziehen, beispielsweise durch Beteiligung an der Ausarbeitung zu Transparenzportalen und – in leitender Funktion – am Grundlagenpapier zu „Informationsfreiheit by Design“ (Tz. 12.5).
12.1 Beanstandungen
2022 hat der schleswig-holsteinische Gesetzgeber das IZG-SH geändert und damit auch die Befugnisse der/des Landesbeauftragten für Informationszugang erweitert (41. TB, Tz. 12.4). So regelt der neue § 14 Abs. 5 IZG-SH, dass für den Fall, dass die oder der Landesbeauftragte für Informationszugang Verstöße gegen das IZG-SH feststellt, sie oder er diese gegenüber der informationspflichtigen Stelle beanstanden kann. 2023 lagen uns mehrere Fälle vor, in denen wir diese Möglichkeit in Erwägung ziehen mussten. Hierbei war zu beachten, dass wir vor dem Aussprechen einer Beanstandung nicht nur der betroffenen Stelle, sondern im Anschluss daran auch der zuständigen Rechts-, Dienst- oder Fachaufsichtsbehörde Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen.
Eine solche Beanstandung haben wir nunmehr gegenüber der Apothekerkammer Schleswig-Holstein ausgesprochen. Wir hatten festgestellt, dass ein nach § 4 IZG-SH beantragter Informationszugang zu einem Impfplan ohne nachvollziehbare Gründe abgelehnt und damit gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 IZG-SH bzw. § 6 Abs. 1 Satz 3 IZG-SH verstoßen wurde.
Problematisch war nicht nur, dass die Monatsfrist des IZG-SH zur Beantwortung einer Anfrage nicht eingehalten wurde, sondern die dargelegten Gründe für die Ablehnung der Auskunft waren auch nicht stichhaltig. Die Argumentation der Apothekerkammer, dass die genannten Regelungen des Arzneimittelgesetzes und Heilmittelwerbegesetzes der Weitergabe von Informationen entgegenstünden, war nicht nachvollziehbar. Die vorgebrachte Argumentation war deswegen besonders überraschend, weil sich in den genannten Normen die behaupteten Aussagen überhaupt nicht finden ließen. Diese Normen regeln vielmehr Verpflichtungen zur Information sowie Werbeverbote – zu Gründen, die einer Herausgabe der begehrten Informationen möglicherweise entgegenstehen könnten, stand dort nichts. Natürlich ist der Schutzzweck der genannten Regelungen, dass bestimmte Medikamente nicht einfach für jeden Menschen im Zugriff sein dürfen, nachvollziehbar. Doch dies führt nicht dazu, dass interessierten Personen generelle Informationen hierüber vorenthalten werden dürfen.
Es ist bereits absehbar, dass wir auch im Jahr 2024 von dem Instrument der Beanstandung Gebrauch machen werden.
Was ist zu tun?
Das Mittel der Beanstandung ist bei Verstößen gegen das IZG-SH zu nutzen, um den informationspflichtigen Stellen gegenüber mit Nachdruck darzulegen, wenn sie nach Überzeugung der Landesbeauftragten für Informationszugang bei der Umsetzung der Informationsfreiheit bewusst Fehler machen.
12.2 Top 5 der Themen in Schleswig-Holstein
Nach § 14 Abs. 1 IZG-SH kann eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet worden ist oder dass sie von einer informationspflichtigen Stelle eine unzulängliche Antwort erhalten hat, die oder den Landesbeauftragten für Informationszugang anrufen. Einige Beschwerdegründe von Petentinnen und Petenten wiederholten sich auch 2023 mehrfach. Die Top 5 der Beschwerden unterscheiden sich kaum von denen der letzten Jahre (vgl. u. a. 41. TB, Tz. 12.3):
Der häufigste Grund war erneut, dass die informationspflichtige Stelle nicht auf den Antrag auf Informationszugang fristgerecht reagierte. Nach § 5 Abs. 2 IZG-SH besteht eine Frist von einem Monat nach Eingang des Antrags für die Zugänglichmachung zu den Informationen, wobei diese Frist nicht ausgereizt werden muss. Vielmehr hat die Auskunft „so bald wie möglich“ zu erfolgen. Sind die Informationen derart umfangreich und komplex, dass die Frist nicht eingehalten werden kann, so kann die informationspflichtige Stelle die Frist auf höchstens zwei Monate verlängern. Dies ist jedoch der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller innerhalb des ersten Monats mitzuteilen. Und auch eine Ablehnung des Antrags muss nach § 6 IZG-SH innerhalb dieser Fristen mitgeteilt werden. In den meisten Fällen reagieren die informationspflichtigen Stellen, sobald sie wissen, dass wir eingebunden worden sind – wenn auch ihre Handlungen dann nicht immer formal korrekt sind.
Das bringt uns zum zweiten Beschwerdegrund, dass insbesondere bei (Teil-)Ablehnungen die Form des § 6 IZG-SH nicht eingehalten wird. Vorgeschrieben ist u. a., dass der antragstellenden Person die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen sind. Wenn überhaupt, wird teilweise von den Behörden nur auf allgemeine „rechtliche“ Ablehnungsgründe verwiesen. Notwendig wäre nicht nur die konkrete Benennung des einschlägigen Ablehnungsgrunds nach §§ 9 oder 10 IZG‑SH, sondern auch eine Auseinandersetzung mit den dort aufgeführten Merkmalen inklusive Darstellung der in der Regel erforderlichen Abwägung und gegebenenfalls eingeholten Anhörungen bzw. Einwilligungen. Auch wird aus den Begründungen nicht immer ersichtlich, ob geprüft wurde, dass gegebenenfalls nur eine teilweise Ablehnung geboten ist bzw. eine Schwärzung der nicht herausgebbaren Passagen im Text ausreicht. Schließlich fehlt immer mal wieder die Belehrung über die Rechtsschutzmöglichkeiten im Sinne des § 6 Abs. 4 IZG-SH.
Dies ist oftmals eine Folgeerscheinung des Problembereichs, dass die informationspflichtigen Stellen nicht erkennen, dass tatsächlich ein Antrag nach dem IZG-SH vorliegt. So ist der Antrag formfrei und muss auch keinen direkten Bezug zum IZG-SH beinhalten. Lediglich muss erkennbar sein, zu welchen Informationen der Zugang begehrt wird. Auch Antragstellungen über das Portal Fragdenstaat.de per E-Mail, in denen übrigens zumeist auf das IZG-SH verwiesen wird, sind zu bearbeiten.
In anderen uns vorliegenden Fällen wurden z. B. derartige Anträge in Form von Bürgerfragen in Gemeinderatssitzungen oder einfach fernmündlich oder im persönlichen Gespräch gestellt. Auch diese müssen in der Regel als Anträge nach dem IZG-SH angesehen und entsprechend beschieden werden. In unklaren Fällen ist die informationspflichtige Stelle aufgefordert, nachzufragen und gegebenenfalls eine Präzisierung zu erbitten.
Immer mal wieder werden auch die Gründe für den Antrag auf Informationszugang durch die Stelle hinterfragt und diese gegebenenfalls in die Entscheidungsgründe über den Antrag aufgenommen. Das IZG-SH bietet allen Menschen (nicht nur Bürgerinnen und Bürgern in Schleswig-Holstein) den Anspruch auf Zugang zu den bei einer informationspflichtigen Stelle vorhandenen Informationen. Der Grund für die Anfrage ist dabei in den weit überwiegenden Fällen unbeachtlich. Es schadet dem Antrag beispielsweise nicht, wenn damit eigene Interessen verfolgt werden. Einzig bei der Frage, ob der Antrag offensichtlich missbräuchlich im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 IZG-SH gestellt wurde, ist die Motivation der Antragstellerin bzw. des Antragstellers relevant.
Tatsächlich ist auch im Berichtszeitraum mehrfach von informationspflichtigen Stellen zumindest erwogen worden, bei mehrfacher Antragstellung von diesem Ablehnungsgrund auszugehen. Allerdings zeigt schon die Formulierung des Gesetzes, dass die Antragstellung „offensichtlich“ missbräuchlich sein muss, dass hieran sehr enge Grenzen zu setzen sind. Der Zweck der Antragstellung muss in diesen Fällen klar nicht auf die Informationsbeschaffung, sondern die Störung der Arbeitsabläufe der Stelle bzw. deren Lahmlegung liegen. Wiederholte Anträge zum selben Sachverhalt könnten hierfür zwar ein Indiz sein. Wenn sich eine Person für viele Sachverhalte einer oder mehrerer Behörden interessiert und daher zahlreiche unterschiedliche Anträge stellt, liegt aber keine offensichtlich missbräuchliche Antragstellung vor. Ein Regulativ kann in diesen Fällen die Möglichkeit sein, für Auskünfte Gebühren im Rahmen der Landesverordnung über Kosten nach dem Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (IZG-SH-KostenVO) zu erheben. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass für einfache Auskünfte mit Aufwand zwischen 30 und 45 Minuten keine Gebühren erhoben werden dürfen und auch darüber hinaus die KostenVO Obergrenzen setzt.
Die Grundlagen zum IZG-SH haben wir in einer Broschüre zusammengefasst, die regelmäßig aktualisiert wird und unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann:
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/praxisreihe/Praxisreihe-7-Informationszugang.pdf
Kurzlink: https://uldsh.de/tb42-12-2a
Was ist zu tun?
Den Beschwerden von Petentinnen und Petenten ist nachzugehen. Zu unseren Aufgaben gehört es, informationspflichtige Stellen auf Fehler in der Umsetzung des Informationszugangsrechts hinzuweisen. Damit solche Fehler gar nicht erst auftreten, werden wir die Schulung bzw. Information über das IZG-SH gegenüber öffentlichen Stellen intensivieren.
12.3 Besondere Fälle und Fragen
Im Berichtszeitraum hatten wir einige besondere Anfragen und Beschwerden, die über die typischen Fragestellungen (Tz. 12.2) hinausgingen.
So waren zwei Fälle an uns herangetragen worden, in denen Stadtwerke die Auskunft mit der Begründung verweigerten, keine informationspflichtige Stelle zu sein. Diese Stadtwerke waren jeweils als GmbH ausgestaltet, aber eine 100%ige Tochter der Stadt. Nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 IZG-SH können auch derartige juristische Personen informationspflichtige Stellen sein, soweit ihnen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in den Handelsformen des öffentlichen Rechts übertragen wurden (sogenannte Beleihung). Als Beispiele nennt das Gesetz u. a. Energieerzeugung und -versorgung. Allerdings war es hier fraglich, ob die Stadtwerke tatsächlich in der oben genannten Form beliehen wurden und in den Handelsformen des öffentlichen Rechts tätig wurden. Dies konnten wir nach mehrfacher schriftlicher Diskussion mit den Stadtwerken nicht bejahen, sodass die Verweigerung der Auskunft bestehen blieb.
Diese Situation sehen wir jedoch als problematisch an, insbesondere bei Unternehmen, die sich zu 100 Prozent in der Hand einer Kommune bzw. Stadt befinden. In anderen Bundesländern unterliegen solche Unternehmen eindeutig der Auskunftspflicht; es ist dort nicht möglich, sich etwa durch Ausgründungen dieser Pflicht zu entziehen. Wir haben daher den Gesetzgeber in Schleswig-Holstein hierüber informiert und ihm einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzes unterbreitet. Insbesondere die Aufzählung der Anwendungsfälle in § 2 Abs. 3 Nr. 2 IZG-SH zeigt, dass ursprünglich der Gesetzgeber durchaus solche Fälle im Blick hatte. Daher hoffen wir auf eine schnelle Gesetzesänderung.
In einem anderen Fall ging es um die Frage, ob die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) und dort insbesondere die Regelungen zur nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung die Anwendung des IZG-SH ausschließt. Aus § 3 Satz 2 IZG-SH ergibt sich, dass zwar Rechte auf Zugang zu Informationen, die andere Gesetze einräumen, unberührt bleiben. Jedoch werden diese nicht per se zu Spezialgesetzen, die das IZG-SH ausschließen würde. Somit kann auch auf Informationen, die nichtöffentliche Sitzungen einer Gemeindevertretung betreffen, ein Anspruch nach dem IZG-SH geltend gemacht werden. Im Rahmen der Prüfung der Ausschlussgründe nach §§ 9 und 10 IZG-SH ist dann der jeweilige Grund für die Nichtöffentlichkeit der Sitzung und deren Auswirkung auf den Zugang zu den angefragten Informationen zu berücksichtigen. Absolut ausgeschlossen ist der Zugang jedoch nicht. Insbesondere kann nach einiger Zeit der jeweilige Ausschlussgrund entfallen – etwa nach Abschluss der Beratungen. Wäre dies anders, wären alle dort eingebrachten Informationen (mit Ausnahme der nach § 35 Abs. 3 GO zu veröffentlichenden Beschlüsse) dem Informationszugang für immer entzogen.
Mehrfach hatten wir die Problematik zu behandeln, dass eine Kommune oder andere informationspflichtige Stellen Gutachten oder Stellungnahmen nicht beauskunften wollten. Begründet wurde dies damit, dass sie dem Schutz der Vertraulichkeit der Beratungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IZG-SH unterlägen. Nach unserer Ansicht, die sich mit Kommentarliteratur deckt und aktueller Rechtsprechung folgt, schützt die oben genannte Norm den Beratungsvorgang. Nicht davon automatisch umfasst sind Informationen bzw. Dokumente, die der Beratung zugrunde liegen. Dies können insbesondere vorher eingeholte Gutachten und Stellungnahmen sein.
In einem anderen Fall wollte die Antragstellerin gegenüber der informationspflichtigen Stelle anonym bleiben. Die Behörde jedoch bestand darauf, identifizierende Informationen von ihr zu erhalten, um u. a. die Gebührenzahlung zu gewährleisten. Wir vertreten die Ansicht, dass eine Antragstellung anonym bzw. unter Pseudonym und auch Beauskunftung so weit wie möglich zu gewähren ist. Der Anspruch auf Informationszugang wurde bewusst vom schleswig-holsteinischen Gesetzgeber ohne weitere Voraussetzungen ausgestaltet. Die gesetzliche Situation auf Bundesebene oder in einigen anderen Ländern unterscheidet sich in diesem Punkt vom IZG-SH.
Insbesondere kommt es nicht auf die Person des Antragstellers bzw. der Antragstellerin an. Bei Gebührenbescheiden muss dann im Einzelfall geprüft werden, ob diese so zugestellt werden und die Zahlungen so geleistet werden können, dass ein Antragsteller seinen Namen nicht zu nennen braucht und sich auch nicht anderweitig identifizieren muss.
Eine Ausnahme könnte für solche Fallgestaltungen gelten, bei denen die Gefahr besteht, dass ohne die Kenntnis von der Person der Antragstellerin bzw. des Antragstellers und deren/
dessen Anschrift eine eventuell entstehende Gebührenpflicht nicht durchsetzbar ist. Bei der Beurteilung, ob dieser Fall vorliegen könnte, ist zum einen zu prüfen, ob überhaupt – z. B. bei einfachen Auskünften – ein kostenauslösender Verwaltungsaufwand entstehen könnte, zum anderen ist die Erkennbarkeit einer Zahlungswilligkeit der antragstellenden Person relevant. Auf jeden Fall ist die Kenntnis des Namens oder der Adresse der antragstellenden Person dann nicht erforderlich, wenn bei einer kostenpflichtigen Informationsgewährung die antragstellende Person zahlungswillig ist und eine Bezahlung auch ohne Namensnennung erfolgen kann. Im uns vorliegenden Fall wurde stets die Zahlungswilligkeit von der Petentin erklärt. Es hätte durchaus zumindest Zahlungsmöglichkeiten unter Pseudonym – etwa durch Vorleistung – gegeben. Der Vorgang war 2023 noch nicht abgeschlossen, sodass wir über den weiteren Verlauf im kommenden Tätigkeitsbericht berichten werden.
In zwei Fällen im Berichtsjahr wurden wir von informationspflichtigen Stellen überraschenderweise gebeten, die Übermittlung der gewünschten Informationen zu übernehmen. Vorangegangen waren nicht bzw. nicht ausreichend erfolgte Auskünfte, die dann aufgrund unserer Einbindung doch noch erweitert werden konnten. Dies erfolgte dann im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens. Die Petenten erhielten keinen Bescheid, sondern wir sollten die Informationen weiterleiten. In beiden Verfahren haben wir den informationspflichtigen Stellen deutlich gemacht, dass sie selbst in der Pflicht sind, einen direkten Bescheid den Petenten gegenüber zu erlassen. Unsere Rolle erstreckt sich nicht auf einen Botendienst.
Ein weiterer Fall betraf den Zugang zur Kommunikation zwischen einem Kammerpräsidenten und einem Bundesminister. 2022 hatte die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland eine Entschließung veröffentlicht, in der eindringlich darauf hingewiesen wurde, dass die behördliche Kommunikation umfassend den Regeln der Informationsfreiheit unterliegt (41. TB, Tz. 12.1). Im vorliegenden Fall war die Herausgabe der Kommunikation zunächst deshalb verweigert worden, weil der Kammerpräsident privat kommuniziert habe. Auf unsere Einbindung hin wurde dies noch einmal von der informationspflichtigen Stelle überprüft, sodass wir damit erreichen konnten, dass doch zumindest ein Teil der erfragten E-Mails an den Petenten übermittelt wurde.
Was ist zu tun?
Auch aus spezielleren Fällen lassen sich allgemeine Erkenntnisse zur Umsetzung des Informationszugangsrechts ableiten. Bei Unklarheiten helfen gerichtliche Entscheidungen.
12.4 Entschließungen der IFK
Anfang 2023 hatten wir turnusgemäß unseren Vorsitz der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK) an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) abgegeben. Im Rahmen des zugehörigen Arbeitskreises und insbesondere der Konferenzen in Berlin und Bonn haben wir an mehreren Entschließungen maßgeblich mitgewirkt.
1. Entschließung der 44. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland vom 14. Juni 2023 in Berlin: „Die Demokratie braucht starke Medien – Bundespressegesetz jetzt einführen!“
Der Bund verfügt im Gegensatz zu den Ländern nicht über ein Pressegesetz. Bis zum Jahr 2013 hat sich die Presse für ihren Auskunftsanspruch
auch gegenüber Bundesbehörden auf die Pressegesetze der Länder berufen. 2013 hat das Bundesverwaltungsgericht jedoch entschieden, dass dies unzulässig sei. Vielmehr ergebe sich der presserechtliche Auskunftsanspruch gegenüber Bundesbehörden unmittelbar aus dem Recht auf Pressefreiheit aus dem Grundgesetz. Es sei Sache des Bundesgesetzgebers, einen Informationszugang zu regeln (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 20. Februar 2013, Az.: 6 A 2.12), der jedenfalls nicht hinter den landespresserechtlichen Ansprüchen zurückbleiben darf (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 8. Juli 2021, Az.: 6 A 10.20).
Auch zehn Jahre nach der Entscheidung fehlt eine konkrete Ausgestaltung und damit die Rechtssicherheit, ob und wie Bundesbehörden der Presse Auskunft zu gewähren haben. Der alleinige Rückgriff auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes wird der von Verfassung wegen gebotenen besonderen Stellung der Medien nicht gerecht. Die Regierungsparteien haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, diese Lücke zu schließen. Ein konkreter Gesetzentwurf für ein Bundespressegesetz steht aber nach wie vor aus.
Eine starke Presse ist für eine lebendige Demokratie existenziell. Dazu ist sie auf einen raschen und umfassenden Informationszugang angewiesen.
Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland fordert den Bundesgesetzgeber auf, zeitnah ein effizientes Bundespressegesetz zu schaffen, das der herausragenden Rolle der Presse und den Erfordernissen einer modernen Medienlandschaft Rechnung trägt.
2. Entschließung der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland am 07.11.2023 in Bonn: „25 Jahre Århus-Konvention – Veröffentlichungsanspruch muss ins Gesetz!“
Nach 25 Jahren Århus-Konvention ist die so wichtige proaktive Veröffentlichung von Umweltinformationen in Deutschland immer noch abhängig vom Transparenzwillen der Behörden. Das muss sich ändern.
Mit der Århus-Konvention wurden 1998 erstmals internationale Mindeststandards für den Zugang zu Umweltinformationen völkerrechtlich verankert. Das Übereinkommen fußt auf der Erkenntnis, „dass jeder Mensch (…) die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwärtiger und künftiger Generationen zu schützen und zu verbessern“, und „zur Wahrnehmung dieser Pflicht Zugang zu Informationen, ein Recht auf Beteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten haben“ muss.
Die Bestimmungen der Konvention fanden durch die EU-Umweltrichtlinie aus dem Jahr 2003 Eingang ins Gemeinschaftsrecht und im Folgenden ins nationale Recht. So sehen die Umweltinformationsgesetze in Deutschland vor, dass Behörden Umweltinformationen proaktiv und nicht nur auf Antrag Einzelner veröffentlichen müssen. Allerdings stellt diese Pflicht zur „Unterrichtung der Öffentlichkeit“ in den allermeisten Ländern und auf Bundesebene keinen selbstständigen, einklagbaren Anspruch für jedermann dar.
Bei Verstößen gegen die Pflicht fehlt somit die Möglichkeit zur Durchsetzung: Die Nichtbeachtung ist nach aktueller Gesetzeslage nicht gerichtlich überprüfbar, und die bloße Veröffentlichungspflicht droht zu verpuffen. Nur in den Transparenzgesetzen von Hamburg, Bremen und Rheinland-Pfalz besteht bislang – in gewissem Maße – ein subjektives Recht auf Veröffentlichung.
Um die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf Zugang zu Umweltinformationen – ganz im Geiste der Århus-Konvention – zu stärken, ist eine Novellierung des Umweltinformationszugangsrechts nötig. Die IFK fordert die bisher untätigen Gesetzgeber dazu auf, die Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit zu modernisieren und als selbstständigen Anspruch zu formulieren.
3. Entschließung der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland am 07.11.2023 in Bonn: „Künstliche Intelligenz (KI) verantwortungsvoll für die Informationsbereitstellung nutzen!“
Künstliche Intelligenz (KI) kann bei der Umsetzung der Informationsfreiheit helfen. Die schnelle und fristwahrende Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenz von Behördenhandeln scheitert immer wieder am Aufwand bei der Sichtung der vorhandenen Informationen und deren Bewertung durch die informationspflichtige Stelle.
KI ist auf dem digitalen Vormarsch und wird vermehrt im Alltag eingesetzt. Durch ihren Einsatz können organisatorische Abläufe optimiert und Arbeitsschritte automatisiert werden. Auch für die Informationsfreiheit kann das Potenzial von KI genutzt werden, um die Bereitstellung von amtlichen Informationen zu vereinfachen und damit zu fördern. Es werden bereits Prototypen von KI-Tools genutzt, die z. B. durch Zusammenfassungsfunktionen oder Fließtextgenerierung die Arbeit der Verwaltungsmitarbeitenden unterstützen. Im Justizbereich gibt es u. a. auch Projekte, bei denen z. B. gerichtliche Entscheidungen mithilfe von KI-basierten Schwärzungstools veröffentlicht werden können.
Was beim Einsatz von KI aber immer beachtet werden muss: KI ist ein „Werkzeug“, das für den optimalen Einsatz durch den Menschen korrekt angelernt und überwacht werden muss, um amtliche Informationen zu sondieren und Fehler bei deren Einschätzung zu vermeiden. Beim Einsatz von KI durch öffentliche Stellen muss deshalb gewährleistet sein, dass die eingesetzten Verfahren durch ausreichende Transparenz und durch technisch-organisatorische Gestaltung überprüfbar und beherrschbar sind. Gesetzliche Bestimmungen und ethische Grundsätze sind dabei zu berücksichtigen. Dazu gehören auch der Persönlichkeitsrechtsschutz und die datenschutzrechtlichen Vorgaben.
So können perspektivisch in wenigen Schritten beantragte Informationen bereitgestellt werden. Ebenso kann auch die proaktive Veröffentlichung im Rahmen der Transparenzportale erleichtert werden. Die abschließende Entscheidung muss jedoch zwingend durch den Menschen erfolgen. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland sieht die KI unter Beachtung der oben genannten Grundsätze im Informationsfreiheitsbereich als ein effektives Instrument zur schnellen Informationsbereitstellung an.
4. Entschließung der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland am 07.11.2023 in Bonn: „Moderne Transparenzgesetze bundesweit – für eine lebendige Demokratie!“
Die Informationsfreiheitsgesetze sind ein wichtiges Instrument, um die Akzeptanz der Demokratie zu befördern. Sie ermöglichen durch einen allgemeinen und voraussetzungslosen Zugang zu Informationen Beteiligung und Kontrolle.
Betrachtet man die existierenden Regelungen über den Zugang zu amtlichen Informationen, so gibt es in Deutschland derzeit eine „Dreiklassengesellschaft“:
- In einigen Bundesländern gibt es Transparenzgesetze mit proaktiven Veröffentlichungspflichten auf staatlichen Transparenzplattformen.
- In einigen Ländern und im Bund gibt es Informationsfreiheitsgesetze, die den Informationszugang nur auf Antrag gewähren.
- In Bayern und Niedersachsen gibt es nach wie vor kein voraussetzungsloses Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen.
Moderne Transparenzgesetze zeichnen sich im Kern dadurch aus, dass sie die proaktive Informationsbereitstellung in Transparenzportalen durch öffentliche Stellen der Bundes-, Landes- sowie der kommunalen Ebene gewährleisten.
Darüber hinaus sollten bei der Ausgestaltung moderner Transparenzgesetze weitere wichtige Gesichtspunkte einbezogen werden:
- die Zusammenlegung von IFG und UIG,
- den Verzicht auf Bereichsausnahmen,
- die Möglichkeit einer niedrigschwelligen Antragstellung,
- die Pflicht zur Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe von Informationen bei bestehenden Geheimhaltungsinteressen und
- Reduzierung und Harmonisierung der Ausschlussgründe.
Die IFK fordert die Bundes- und Landesgesetzgeber dazu auf, mit modernen Transparenzgesetzen das Recht auf Informationszugang deutschlandweit auf ein einheitlich hohes Niveau zu bringen und die Informationsfreiheits- und Transparenzbeauftragten des Bundes und der Länder mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten.
Die Protokolle und weitere Informationen zu den Sitzungen der IFK können hier abgerufen werden:
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/
1347-.html
Kurzlink: https://uldsh.de/tb42-12-4a
Was ist zu tun?
Wir werden uns weiterhin intensiv in die Diskussionen und Entschließungen der IFK und des zugehörigen Arbeitskreises einbringen.
12.5 Informationsfreiheit by Design
Noch aus unserem Vorsitzjahr der IFK haben wir die Aufgabe übernommen, in leitender Funktion mit Kolleginnen und Kollegen von Bund und Ländern (Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen) ein Informationspapier zu „Prinzipien der Informationsfreiheit und Umsetzungshinweise zur ‚Informationsfreiheit by Design‘“ zu erstellen.
Zu „Informationsfreiheit by Design“ zählt die Gesamtheit technischer und organisatorischer Instrumente nach dem Stand der Technik, die der Wahrnehmung und Erfüllung der Rechte nach den Informationsfreiheits-, Umweltinformations- und Transparenzgesetzen des Bundes und der Länder dienen.
Damit unterstützt „Informationsfreiheit by Design“ einerseits informationspflichtige Stellen bei der Erfüllung eines beantragten Zugangs zu herauszugebenden Informationen. Mit einer guten organisatorischen Vorbereitung und der Nutzung digitaler Techniken kann die Verwaltung ihren Aufwand erheblich senken. Für Antragstellende wird andererseits der Informationszugang beschleunigt und erleichtert. Besonders mit einem entsprechend gestalteten E‑Akte-Verfahren kann der Informationszugang schneller und mit weniger Verwaltungsaufwand und damit auch kostengünstiger erfolgen. Die proaktive Bereitstellung bzw. Veröffentlichung von Informationen entsprechend den jeweils geltenden Transparenzpflichten kann durch „Informationsfreiheit by Design“ ebenfalls erleichtert werden.
Zunächst wurden die maßgeblichen Prinzipien erarbeitet und abgestimmt:
- Recht auf Informationszugang,
- planvolles Vorgehen / Effizienz durch Vorbereitung,
- Vollständigkeit,
- Kontextualisierung / Integrität / Verfügbarkeit,
- Offenheit und Kooperation,
- strukturierter Prozess zur Identifizierung von Ausschlussgründen und Abwägung von Interessen,
- Verarbeitbarkeit,
- Management von Informationsfreiheit als andauernder Prozess,
- geringer Aufwand, niedrige bzw. keine Kosten.
Hieraus ließen sich Maßnahmen ableiten, die u. a. durch Prüffragen in einer Checkliste informationspflichtige Stellen dabei unterstützen, ihre Verfahren und Prozesse so zu gestalten, dass Informationsfreiheitsanfragen effektiv und vollständig beantwortet werden können. Eingebunden waren nicht nur die Kolleginnen und Kollegen der anderen Beauftragten für Informationsfreiheit, sondern auch Praktikerinnen und Praktiker aus informationspflichtigen Behörden.
Es ist geplant, dass das Papier im ersten Quartal 2024 von der IFK beschlossen und dann veröffentlicht wird. Unter anderem wird es über unsere Informationsseite zur Informationsfreiheit in Schleswig-Holstein abrufbar sein:
https://www.datenschutzzentrum.de/informationsfreiheit/
Kurzlink: https://uldsh.de/tb42-12-5a
Was ist zu tun?
Das Papier „Informationsfreiheit by Design“ soll nicht nur eine Momentaufnahme darstellen, sondern für längere Zeit Hilfestellung geben. Daher soll es nach der Veröffentlichung immer wieder aktualisiert werden. Hilfreich dafür ist der Praxis-Check – die Rückmeldungen von informationspflichtigen Stellen.
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |