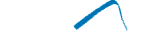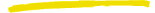4.2 Polizei
4.2.1 Einsatz von Bodycams künftig auch in Wohnungen?
Im Berichtszeitraum haben wir gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Landtag zu einem Gesetzentwurf zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes Stellung genommen, mit dem der Einsatz von Bodycams durch die Polizei auch in Wohnungen ermöglicht werden soll.
Die gegenwärtige gesetzliche Regelung für den Einsatz von Bodycams schließt deren Verwendung in Wohnungen aus. Bereits im Pilotprojekt der Landespolizei zur Erprobung von Bodycams zeigte sich, dass – obwohl ausdrücklich ausgeschlossen – die Bodycams in mehreren Fällen auch in Wohnungen zum Einsatz kamen (vgl. 37. TB, Tz. 4.2.3). Seitdem haben die politischen Forderungen nach einer gesetzlichen Ermächtigung für den Bodycam-Einsatz in Wohnungen zugenommen. Die Landesregierung hat im Berichtszeitraum einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Wir haben dazu schriftlich und in einer mündlichen Anhörung im Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages Stellung genommen.
Angesichts der erhöhten Gefährdungslage für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei Einsätzen in Wohnungen mag die Forderung nach Bodycams als Schutzmaßnahme nachvollziehbar sein. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass Wohnungen dem besonderen Schutz des Artikels 13 Grundgesetz (GG) unterliegen. Es handelt sich um persönliche Rückzugsorte, die die Privatsphäre von Menschen berühren. Auch unbeteiligte Dritte, insbesondere Kinder, können durch die Aufnahmen mit betroffen sein. Das Erstellen von Video- und Tonaufnahmen in diesem besonders geschützten Bereich unterliegt daher hohen verfassungsrechtlichen Schranken. Ob eine mit dem Grundgesetz vereinbare und gleichzeitig praktikable Nutzung von Bodycams in Wohnungen möglich ist, ist fraglich. In der Rechtswissenschaft werden erhebliche Bedenken geäußert, auf die wir in unserer Stellungnahme hingewiesen haben.
Daneben haben wir, größtenteils unabhängig vom Einsatz in Wohnungen, weitere Empfehlungen ausgesprochen:
- Eine im Gesetzentwurf vorgesehene Ausnahme von der Pflicht, betroffene Personen auf die Aufzeichnung hinzuweisen, ist nicht nachvollziehbar und sollte gestrichen werden.
- Die Pflicht zum Hinweis auf Aufzeichnungen sollte vielmehr ausdrücklich auch für das Pre-Recording geregelt werden.
- Wenn der Einsatz in Wohnungen erlaubt wird, sollte gesetzlich klargestellt werden, dass die Aufzeichnung von Inhalten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu unterbleiben hat.
- Aufzeichnungen aus Wohnungen sollten gekennzeichnet werden, damit die gesetzlichen Schranken auch bei der Weiterverarbeitung beachtet werden.
- Für die Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für Bodycam-Aufzeichnungen auf Antrag betroffener Personen sollten nicht zu hohe Anforderungen vorgesehen werden.
Was ist zu tun?
Der Gesetzentwurf zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes zum Einsatz von Bodycams sollte entsprechend angepasst werden. Von dem Einsatz von Bodycams in Wohnungen ist aufgrund der verfassungsrechtlichen Risiken abzuraten.
4.2.2 Filmen und Fotografieren von Polizeibeamten im Einsatz
Nicht nur die Polizei nutzt Videotechnik im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern bei Einsätzen (siehe oben Tz. 4.2.1). Immer häufiger kommt es vor, dass Bürgerinnen und Bürger das polizeiliche Handeln bei Einsätzen fotografieren oder filmen. Als zuständige Ordnungswidrigkeitenbehörde für etwaige von den Bürgerinnen und Bürgern dabei begangene Datenschutzverstöße haben wir im Berichtszeitraum eine Reihe von Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhalten. Teilweise wurden von der Polizei auch die Smartphones beschlagnahmt, mit denen Fotos gefertigt worden waren.
Das Fotografieren oder Filmen von Polizeibeamten im Einsatz verstößt nicht regelmäßig gegen das Datenschutzrecht und ist nicht per se eine Ordnungswidrigkeit. Es kommt auf die Bewertung des Einzelfalls an:
- Geprüft werden muss zunächst, ob die DSGVO für die fotografierenden oder filmenden Privatpersonen überhaupt anwendbar ist. Sie gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Ausübung ausschließlich persönlicher Tätigkeiten.
- Ist die DSGVO anwendbar, etwa weil die Absicht erkennbar ist, dass die Aufzeichnungen an Behörden oder andere Organisationen weitergegeben werden sollen, ist zu prüfen, ob es für die Anfertigung und die weitere Verarbeitung der Aufzeichnungen eine Rechtsgrundlage gibt. Die DSGVO erlaubt z. B. die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese zur Wahrung eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen.
- Der Begriff des berechtigten Interesses ist weit auszulegen. Jedes ideelle Interesse soll darunterfallen. Die Absicht, die Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns nachträglich überprüfen zu lassen, kann z. B. im Einzelfall ein berechtigtes Interesse sein. Kein berechtigtes Interesse ist hingegen die Absicht, Bildmaterial zu sammeln, um dies für Drohungen oder Einschüchterungen der Polizeibeamtinnen und -beamten zu nutzen. Auch die Veröffentlichung von personenbezogenen Bildern und Filmen im Internet kann in der Regel nicht auf ein berechtigtes Interesse gestützt werden.
- Dem berechtigten Interesse sind die schutzwürdigen Interessen der Polizeibeamtinnen und -beamten gegenüberzustellen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht am eigenen Bild gelten auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Dienst. Das Maß des Schutzes unterscheidet sich jedoch bei Funktionsträgern und natürlichen Personen: Polizeibeamtinnen und -beamte sind in ihren Persönlichkeitsrechten geringer betroffen und weniger schutzbedürftig, da sie nicht als Privatpersonen, sondern als Repräsentanten des Staates auftreten. Dies ist in der nach der DSGVO erforderlichen Interessenabwägung zu berücksichtigen.
Nach diesen Maßstäben ist im Einzelfall zu beurteilen, ob das Filmen oder Fotografieren rechtmäßig ist oder gegen die DSGVO verstößt. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Aufnahmen zur Drohung, Einschüchterung oder personenbezogener Veröffentlichung im Internet verwendet werden sollen, kann die Polizei mit den Mitteln der Gefahrenabwehr gegen den Verantwortlichen vorgehen.
Werden Smartphones beschlagnahmt, ist zudem die Verhältnismäßigkeit der Beschlagnahme besonders zu prüfen. Dabei ist die Bedeutung des Smartphones für das alltägliche Leben der Betroffenen zu berücksichtigen. Ein Verzicht kann für sie im Alltag weitreichende Folgen haben.
Wir haben bislang in keinem der angezeigten Fälle ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein hinreichender Verdacht für eine Ordnungswidrigkeit konnte nach den genannten Maßstäben auf Grundlage des angezeigten Sachverhalts in keinem der Fälle begründet werden. Bereits eingeleitete Bußgeldverfahren haben wir aus denselben Gründen eingestellt und in einem Fall ein von der Polizei beschlagnahmtes Smartphone an den Betroffenen aushändigen lassen. Gleichwohl musste der Betroffene während der gesamten Verfahrensdauer von etwa sechs Wochen auf sein Smartphone verzichten.
Was ist zu tun?
Film- oder Fotoaufnahmen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verstoßen nicht per se gegen das Datenschutzrecht. Hierfür bedarf es einer sorgfältigen Prüfung im Einzelfall. Die pauschale Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen etwaiger Datenschutzverstöße ist daher nicht zielführend.
4.2.3 Abruf von Melderegisterdaten im Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren sind bei den Betroffenen in der Regel nicht sehr beliebt. Sie leisten aber einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr. Bei jährlich Millionen von registrierten Verkehrsverstößen fallen bei den zuständigen Ordnungsbehörden große Mengen personenbezogener Daten an.
Bei Geschwindigkeitsverstößen wird in der Regel über das Kfz-Kennzeichen der Halter durch eine Abfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ermittelt und zum Sachverhalt befragt. Gelegentlich sind weitere Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers erforderlich. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind die zuständigen Ordnungsbehörden mit entsprechenden Ermittlungsbefugnissen ausgestattet. Dazu gehört auch die Möglichkeit, mithilfe von Melderegisterabfragen weitere personenbezogene Daten zu erheben. Dies darf (und sollte) jedoch nicht pauschal oder ohne besonderen Anlass geschehen, wie der folgende Fall zeigt:
Im Berichtszeitraum wurde einem Betroffenen ein Anhörungsbogen wegen eines festgestellten Geschwindigkeitsverstoßes zugestellt. Die Zustellung erfolgte jedoch nicht an den beim KBA korrekt gemeldeten Hauptwohnsitz des Betroffenen, sondern an einen nicht ständig genutzten Nebenwohnsitz. Dadurch wurde die von der Behörde gesetzte Frist versäumt, was zu weiteren Kosten führte. Der Betroffene beschwerte sich daraufhin zunächst bei der zuständigen Behörde und verlangte in diesem Zusammenhang auch Auskunft darüber, woher die Behörde die Adresse seines Zweitwohnsitzes habe. Die Behörde erstattete daraufhin kommentarlos die durch die Falschzustellung entstandenen Gebühren und Auslagen.
Der Betroffene beschwerte sich daraufhin beim ULD. Im Rahmen der Anhörung teilte die Ordnungsbehörde mit, dass die Adresse des Zweitwohnsitzes durch eine Melderegisterabfrage ermittelt worden sei. Durch ein Büroversehen sei der Anhörungsbogen dann nicht an die (durch die KBA-Abfrage bereits bekannte) Hauptwohnung, sondern an die Nebenwohnung zugestellt worden. Die Melderegisterabfrage sei jedoch rechtlich zulässig gewesen. Die Nachfrage des Betroffenen, woher die Behörde die Adresse des Zweitwohnsitzes habe, sei übersehen worden, da sie in ein allgemeines Beschwerdeschreiben eingebettet gewesen sei. Mit der Erstattung der Säumniszuschläge sei die Angelegenheit als erledigt angesehen worden.
Also alles nur eine Unachtsamkeit? Richtig ist, dass die Ordnungsbehörden das Melderegister abfragen dürfen. Aber darf das in jedem Fall und unter allen Umständen geschehen? Das Bundesmeldegesetz erlaubt solche Abfragen nur, wenn sie zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe „erforderlich“ sind. Außerdem ist die Meldebehörde an den Grundsatz der Datenminimierung gebunden. Beide Grundsätze sollen sicherstellen, dass nicht mehr personenbezogene Daten verarbeitet werden, als zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind.
Aus dem Sachverhalt ergaben sich keine Anhaltspunkte, die weitere Nachforschungen oder Ermittlungen der Ordnungsbehörde erforderlich gemacht hätten. Der aktuelle Name und die Adresse des Beschwerdeführers waren beim KBA hinterlegt. Im Übrigen hat die – offensichtlich nicht erforderliche – Melderegisterauskunft nur dazu geführt, dass der Bußgeldbescheid an die falsche Adresse zugestellt wurde. Die Abfrage war nicht erforderlich und daher unzulässig.
Darüber hinaus haben betroffene Personen das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, aus welchen Quellen eine Behörde ihre personenbezogenen Daten erhoben hat. Auch wenn eine solche Frage in einem allgemeinen Beschwerdeschreiben enthalten ist, muss die Behörde darauf reagieren. Mit der Rückerstattung der Säumnisgebühr wurde zwar der finanzielle Schaden ersetzt, gleichzeitig aber der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch ignoriert.
Was ist zu tun?
So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind der Grundsatz der Erforderlichkeit und der Grundsatz der Datenminimierung zu beachten. Pauschale Melderegisterabfragen in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren sind in der Regel nicht erforderlich.
Wer allgemeine Beschwerdeschreiben bearbeitet, sollte den datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch kennen und diesbezügliche Fragen als entsprechenden Antrag behandeln.
4.2.4 Falsche Auskunft aus dem Melderegister
Ein Bürger wandte sich an uns, weil in einem Polizeibericht als seine vermeintlich aktuelle Meldeanschrift eine Adresse genannt wurde, an der er zu dem damaligen Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren nicht mehr wohnte. Er prüfte zunächst die Einträge im Melderegister dieses Wohnorts. Dort waren der Auszug aus der Wohnung und die Abmeldung korrekt eingetragen. Daraufhin wandte er sich zunächst ohne Erfolg an die Polizei und im Anschluss daran an uns.
Wir haben daraufhin die Polizei um Stellungnahme gebeten, woher die Information über die Adresse stammte und warum diese als aktuell bezeichnet wurde. Die Polizei konnte anhand von Protokolldaten belegen, dass ihr bei der Abfrage aus der Spiegeldatenbank des Melderegisters die alte Anschrift als aktuelle Anschrift angezeigt worden war. Eine Abfrage des Melderegisters durch uns, etwa ein Jahr nach der Abfrage der Polizei, ergab hingegen eine andere Anschrift als aktuelle Anschrift. Die alte Anschrift wurde korrekt als frühere Anschrift angezeigt.
Wir haben uns daraufhin an das Innenministerium gewandt. Dort konnte der Fehler ermittelt werden: Zum Zeitpunkt der Melderegisterabfrage der Polizei war eine fehlerhafte Softwareversion im Einsatz. Diese hatte die Reihenfolge mehrerer vorhandener Datensätze in der Spiegeldatenbank bei einer landesweiten Suche nicht nach ihrer Aktualität sortiert. Somit war der Polizei der ältere Datensatz einer anderen Gemeinde als aktuell angezeigt worden und nicht der neueste Datensatz der Gemeinde des letzten Wohnorts. Zum Zeitpunkt unserer Melderegisterabfrage war der Fehler behoben, sodass wir eine korrekte Auskunft erhalten haben.
Der Beschwerdeführer hatte gegenüber der Polizei die Berichtigung der Adressangabe im Polizeibericht verlangt. Im vorliegenden Fall bestand ein Berichtigungsanspruch nicht. Denn trotz der objektiv falschen Anschrift war der Polizeibericht als solches „richtig“, da er die Erkenntnisse der Polizei zu dem damaligen Zeitpunkt zutreffend wiedergab. Der Bericht selbst war deshalb nicht zu berichtigen. Ein Berichtigungsanspruch kann hingegen bestehen, wenn in den allgemeinen Stammdaten in polizeilichen Verarbeitungssystemen unrichtige Daten gespeichert sind. In einem polizeilichen Vorgang kann eine Berichtigung auch in Form einer Ergänzung in Betracht kommen. Die Richtigkeit ist auch bei einer Weiterverwendung von besonderer Bedeutung: Der Verantwortliche muss gewährleisten, dass unrichtige oder nicht mehr aktuelle personenbezogene Daten nicht übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden (§ 74 Abs. 1 BDSG).
Ob die fehlerhafte Softwareversion zu weiteren unrichtigen Suchergebnissen geführt hat, ist nicht bekannt.
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |