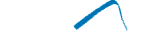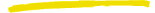23. Tätigkeitsbericht (2001)
13 |
Was es sonst noch zu berichten gibt |
13.1 |
Kampfhundeverordnung und Steuergeheimnis
|
|
Auf den ersten Blick fällt es schwer, eine Beziehung zwischen der Kampfhundeverordnung und dem Steuergeheimnis herzustellen. Trotzdem lagen uns im vergangenen Jahr hierzu stapelweise Anfragen vor. Die betreffenden Kommunen hatten nämlich die Absicht, alle Hundehalter anzuschreiben und mittels Fragebogen zu ermitteln, wer von ihnen einen so genannten Kampfhund besitzt. Hierzu wollten die Ordnungsämter die Adressen aus dem Hundesteuerbestand nutzen und waren ärgerlich, als die Kollegen der Steuerabteilungen die Herausgabe unter Hinweis auf das Steuergeheimnis verweigerten. Deren Argumentation war schlüssig: Die Umsetzung der Kampfhundeverordnung sei eine ordnungsrechtliche Maßnahme und diene nicht dem Besteuerungsverfahren. Die Offenbarung steuerlicher Verhältnisse sei aber nur zur Verfolgung von Verbrechen und einigen anderen schweren Straftaten zulässig. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Hundehalter nicht zur Abgabe der Erhebungsbögen verpflichtet sind, weil die Kampfhundeverordnung eine Erklärungspflicht nicht vorsieht. Wenn es aber nur auf die Erfassung freiwillig gemachter Angaben ankommt, kann die Versendung der Vordrucke auch durch das Steueramt erfolgen, sodass es nicht zu unbefugten Offenbarungen steuerlicher Verhältnisse kommt. Ein Hundehalter, der seinen Bullterrier freiwillig registrieren lässt, bricht nicht das Steuergeheimnis. Die Daten desjenigen, der nicht reagiert, werden dem Ordnungsamt nicht bekannt. Die von vielen kritisierte geringe Effektivität derartiger Aktionen lag also jedenfalls nicht im Steuergeheimnis begründet. |
|
13.2 |
AIDS-Beratung ohne Grenzen
|
|
Ein Petent beschwerte sich, dass seine Akte in einer AIDS-Beratungsstelle nicht nur von seinem Sozialarbeiter, sondern auch von allen anderen Kollegen gelesen werde. Dies war im konkreten Fall besonders heikel, weil persönliche Kontakte zwischen dem Petenten und einem Mitarbeiter der Beratungsstelle bestanden. Sozialarbeiter unterliegen aus gutem Grund der beruflichen Schweigepflicht. Dies gilt auch gegenüber Kollegen, die selbst zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Wünscht der Rat Suchende also ein vertrauliches Gespräch unter vier Augen, so ist dieser Wunsch für den Sozialarbeiter bindend. Ohne Einwilligung des Hilfe Suchenden dürfen die Daten auch intern grundsätzlich nicht weitergegeben werden. Wird die Beratung durch ein Team wahrgenommen, muss diese Vorgehensweise zuvor mit den Betroffenen abgestimmt werden. Dies kann z. B. durch Informationsbroschüren über die Verfahrensweisen der Beratungsstelle, die vor dem ersten Beratungsgespräch ausgehändigt werden, erfolgen. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte stets eine schriftliche Einwilligung eingeholt werden, wenn der Berater personenbezogene Daten seiner Beratungsfälle an weitere Personen weitergeben möchte. Beratungsstellen haben uns bestätigt, dass sich diese Transparenz positiv auf das Vertrauensverhältnis auswirkt bzw. eine fehlende Unterrichtung die Hilfeleistung nachhaltig beeinträchtigen kann. |
|
13.3 |
Mailingaktion der Krebsgesellschaft
|
|
Groß war die Irritation, als ein Petent Werbung von der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e. V. erhielt, lag doch sein Vater aufgrund eines Krebsleidens gerade im Sterben. Noch größer wurden die Befürchtungen, als er feststellte, dass nur die Nachbarn die gleiche Werbesendung erhalten hatten, die bzw. deren Angehörige vor kurzer Zeit wegen eines Krebsleidens in der gleichen Klinik wie sein Vater behandelt worden waren. "Gesunde" Nachbarn hatten keine Post bekommen. Hatte womöglich das Krankenhaus die Anschriften von Patienten weitergegeben?
Die Krebsgesellschaft erklärte uns, dass jährlich drei bis vier Werbeaktionen bundesweit durchgeführt werden. Jeweils etwa eine Million Haushalte erhielten im Rahmen dieser Mailingaktionen Post; auf Schleswig-Holstein entfielen ca. 115.000 Briefsendungen. Man versicherte uns sowohl vonseiten der Gesellschaft als auch des Krankenhauses, dass die Adressdaten nicht aus medizinischen Behandlungen stammen. Nachforschungen ergaben, dass die Adressen von einer Vermittlungsagentur aus der Schweiz gekauft worden waren. Diese Agentur hatte die Adressen wiederum von einem Schweizer Adresshändler erworben. Die Schweizer Firmen erklärten uns, die Daten aus Telefonbüchern des Jahres 1997 entnommen und mit weiteren öffentlichen Quellen abgeglichen zu haben. Nach einem wechselnden Zufallsprinzip würden dann bestimmte Haushalte angeschrieben. Die Mailingaktionen der Krebsgesellschaften hätten nicht nur das Ziel der Versorgung der Bevölkerung mit Informationen, sondern auch das des Einwerbens von Spenden. Daher erfolge die Auswahl der Adressen zudem nach dem Kriterium der von den Wohnadressen abgeleiteten angenommenen Spendenbereitschaft. Trotz intensiver Prüfung - über die Grenzen von Schleswig-Holstein hinaus - konnte der Verdacht des Petenten nicht bestätigt werden. Ein ungutes Gefühl blieb jedoch, nicht nur bei dem Petenten. Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V. hat reagiert. Den konkreten Fall sowie eine Vielzahl weiterer Anfragen will man zum Anlass nehmen, bei zukünftigen Mailingaktionen durch entsprechende Informationen zur Herkunft der Adressen für eine größere Transparenz zu sorgen. |
|
13.4 |
Der geschwätzige Mutterpass
|
|
Werdende Mütter erhalten zu Beginn der Schwangerschaft einen Mutterpass, der zu einem wichtigen Wegbegleiter für die Schwangere wird. Bei jedem Arztbesuch wird darin der Verlauf der Schwangerschaft vermerkt. In den neun Monaten wird die werdende Mutter diesen Pass einer Vielzahl von Ärzten, eventuell aber auch dem Arbeitgeber, dem Sozialamt oder anderen Stellen vorlegen. Der Arzt einer gynäkologischen Abteilung eines Krankenhauses monierte, dass in dem Dokument die Angabe "Allein erziehend - ja/nein" vermerkt ist. Eine Schwangere werde auch dann als allein erziehend eingestuft, wenn sie zwar in fester Beziehung, aber ohne Trauschein lebt. Dieses Merkmal sei medizinisch nicht erforderlich. Keine Mutter ist gesetzlich verpflichtet, einen Mutterpass bzw. ein Kinderuntersuchungsheft (für die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9) zu führen. Die Ausstellung und Nutzung dieser Dokumente ist freiwillig; eine Leistungsgewährung der Krankenkassen kann hiervon nicht abhängig gemacht werden. Dessen ungeachtet ist der Mutterpass bzw. das Kinderuntersuchungsheft aus medizinischer Sicht eine sinnvolle Einrichtung. Werden aber nicht erforderliche Daten eingetragen, so kann aus einer sinnvollen Sache schnell ein Instrument der Diskriminierung werden. Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat das Datenfeld "Allein erziehend" nach anfänglichem Zögern gestrichen. |
|
13.5 |
Telefonkosten- und Internet-Surf-Erlass
|
|
Heftiges Rauschen im Blätterwald und in den sonstigen Medien hat der Bundesfinanzminister mit seiner Absicht hervorgerufen, die Nutzung dienstlicher/geschäftlicher Kommunikationsgeräte (Telefone, PC, Laptops) zu privaten Zwecken und privater Geräte zu dienstlichen/geschäftlichen Zwecken auf den Pfennig genau abzurechnen und entsprechend steuerlich zu berücksichtigen. Dies hätte zu detaillierten Aufzeichnungen des gesamten Kommunikationsverhaltens der Betroffenen geführt. Nach einhelliger Auffassung der Interessenverbände der Steuerpflichtigen, der Wirtschaft und der IT-Industrie sowie der Datenschützer war dieses perfektionistische Verfahren als ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Privatsphäre anzusehen. Weiterhin bestanden Zweifel, ob dies überhaupt mit dem Telekommunikationsrecht zu vereinbaren war. Der Bundesfinanzminister hat sich den vielfältigen Protesten gebeugt und einer pauschalierten steuerlichen Berücksichtigung der Kosten bzw. der geldwerten Vorteile zugestimmt. |
|
13.6 |
IKOTECH II resistent gegen Loveletter-Virus
|
|
Das Auftreten des Loveletter-Virus im Mai 2000 hat in zahlreichen Unternehmen und Behörden zu erheblichen Problemen geführt. In der Presse wurde hierüber ausführlich berichtet. Obwohl die über das CAMPUS-Netz verknüpften und nach dem IKOTECH-II-Standard ausgerüsteten obersten Landesbehörden sogar von Behörden anderer Bundesländer und der Bundesverwaltung mit verseuchten Mails bombardiert worden sind, konnte der Virus hier keinen Schaden anrichten und wurde auch nicht weiterversandt. Der IKOTECH-II-Standard enthält Konfigurationselemente, die die Arbeitsplatzrechner gegen derartige Attacken recht effektiv abschirmen:
Nur das Zusammenspiel dieser Faktoren hat die notwendige Resistenz bewirkt. Der Virenscanner allein hätte z. B. keine Wirkung erzielt, da ihm "Loveletter" zunächst nicht bekannt war. Hierbei handelt es sich um ein klassisches Beispiel dafür, dass es gute Sicherheitslösungen gibt, die gleichwohl nicht überall eingesetzt werden (vgl. Tz. 7.5.2). Alle Behörden, die Ärger mit dem Virus hatten oder ihn weiter verbreitet haben, müssen sich vorwerfen lassen, dass ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht dem Stand der Technik entsprachen; dies war nicht schicksalhaft, sondern fahrlässig. |
|
13.7 |
Geschwindigkeitsmessungen als verkehrserzieherische Maßnahme
|
|
Eine Gemeindeverwaltung beabsichtigte, in Tempo-30-Zonen Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen, bei denen zu schnell fahrende Autos angehalten werden und die Fahrer im Rahmen eines verkehrserzieherischen Gesprächs vor allem mit Kindern und Jugendlichen der Gemeinde konfrontiert werden sollten. Die Gemeinde versprach sich gerade von einer eventuellen persönlichen Bekanntschaft aufgrund von Nachbarschaft der Beteiligten eine größere Einsicht der betroffenen Verkehrsteilnehmer in die verkehrsgefährdenden Auswirkungen ihres Fahrverhaltens. Auch wenn der pädagogische Ansatz dieser Idee anzuerkennen ist und die Gefährdung von Kindern durch Raser sicherlich auch neue Wege erfordert, um auf Autofahrer einzuwirken, muss eine problematische Prangerwirkung für die betroffenen Autofahrer vermieden werden. Die Gemeinde würde im Rahmen dieses Vorhabens in Zusammenarbeit mit der Polizei personenbezogene Daten erheben und an Dritte (Kinder und Jugendliche) weitergeben. Eine Rechtsgrundlage hierfür gibt es nicht. Die Gemeinde müsste deshalb das Einverständnis der jeweiligen Autofahrer zu einem Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen einholen. |
|
13.8 |
Unberechtigte Akteneinsicht einer Versicherung
|
|
Bei einem Verkehrsunfall erlitt ein Petent erhebliche Verletzungen, die seine Berufs- und Erwerbsunfähigkeit zur Folge hatten. Während die Sachschäden anstandslos von der gegnerischen Versicherung beglichen wurden, blieben die Schadenersatz- sowie die Schmerzensgeldforderungen unberücksichtigt. Über den Rechtsanwalt dieser Versicherung erfuhr er, dass man dort einen anonymen Hinweis auf diverse gegen ihn gerichtete Strafverfahren erhalten und Einsicht in die dazugehörigen Vorgänge genommen habe. Unsere Nachprüfung ergab, dass die Akteneinsicht von der Staatsanwaltschaft zu Unrecht gestattet worden war, da die Versicherung kein berechtigtes Interesse darlegen konnte. Die eingesehenen Strafakten betrafen Vorwürfe, die keinen sachlichen Zusammenhang mit dem vorliegenden Versicherungsfall aufwiesen. Dies wurde als ein erheblicher datenschutzrechtlicher Verstoß beanstandet. Die betreffende Staatsanwaltschaft hat den Fehler eingeräumt und uns mitgeteilt, künftig bei Prüfungen von Akteneinsichtsersuchen einen engeren Maßstab anzulegen. |