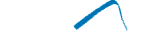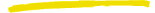20. Tätigkeitsbericht (1998)
4.11 |
Personalwesen |
|
4.11.1 |
Wenn die Gehaltspfändung beim Fachvorgesetzten landet
|
|
|
Der Fachvorgesetzte darf nur dann Kenntnis von Gehaltspfändungen gegen seine Mitarbeiter erhalten, wenn dies für dienstrechtliche Bewertungen und Entscheidungen notwendig ist.
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, die beim Landesbesoldungsamt eingehen, werden regelmäßig in Kopie an die jeweilige personalverwaltende Dienststelle übersandt, um dort die Prüfung zu ermöglichen, ob aufgrund der Pfändung weitere dienstrechtliche Maßnahmen notwendig sind. Bei einer Polizeibehörde war in einem konkreten Fall ein solcher Pfändungsbeschluß über einen Betrag von weniger als 300 DM auch dem Fachvorgesetzten
des Betroffenen mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt worden und landete nach Anhörung des Betroffenen dann für drei Jahre in einem "besonderen Schrank". Hierbei handelte es sich nach unseren Feststellungen nicht um einen Einzelfall.
Um die Vertraulichkeit der Personalaktendaten zu sichern, wurde in das Dienstrecht eine Beschränkung des Personenkreises aufgenommen, der Zugang zu Personalakten erhalten darf. Danach haben Beschäftigte nur Zugangsberechtigung, die im Rahmen der Personalverwaltung mit der Verarbeitung von Personalangelegenheiten beauftragt sind, und nur, soweit dies zu Zwecken der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft erforderlich ist. Im Unterschied zu anderen Verwaltungsvorgängen ist damit über den allgemeinen datenschutzrechtlichen Zweckbindungsgrundsatz hinaus eine besonders vertrauliche Behandlung von Personalvorgängen innerhalb der Verwaltung zu gewährleisten.
Geht es um einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluß, muß der Betroffene dazu gehört werden. Danach ist eine dienstrechtliche Bewertung des Vorgangs notwendig, die zu dokumentieren ist. Ergeben sich aus der Bewertung dienstrechtliche Konsequenzen, sind die Unterlagen in die Personalakte aufzunehmen. Anderenfalls müssen die Unterlagen unverzüglich wieder aus der Personalakte entfernt und vernichtet werden.
In dem geprüften Fall war eine Weiterleitung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an den Fachvorgesetzten nicht erforderlich, da allein schon wegen der geringen Höhe des Betrages die abschließende dienstrechtliche Bewertung dem Leiter der Personalverwaltung möglich gewesen wäre. So mußten wir die Weiterleitung an den Fachvorgesetzten und die anschließende Aufbewahrung beanstanden.
|
||
|
Das Innenministerium machte Nägel mit Köpfen und nahm den Fall zum Anlaß, die Behandlung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen im Polizeibereich durch Runderlaß sachgerecht zu regeln.
|
||
4.11.2 |
Was der Amtsarzt dem Dienstherrn mitteilen darf
|
|
|
Geht ein Bediensteter zum Amtsarzt, ist zu unterscheiden, ob dies auf freiwilliger Basis oder auf gesetzlicher Grundlage geschieht. In dem einen Fall darf die Dienstbehörde nur mit Einwilligung, in dem anderen im Rahmen des Erforderlichkeitsprinzips unterrichtet werden.
Bei einer Lehrkraft war festgestellt worden, daß sie des öfteren alkoholisiert und unfähig war, den Schuldienst ordnungsgemäß wahrzunehmen. Der Amtsarzt wurde deshalb beauftragt, den Betroffenen auf mögliche Alkoholprobleme hin zu untersuchen. Der Betroffene erklärte sich mit einer Untersuchung einverstanden. Als er die Herausgabe der Untersuchungsergebnisse an den Dienstherrn verweigerte, wurden wir um Beratung gebeten. Für dienstrechtliche Entscheidungen bezüglich der gesundheitlichen Eignung von Beamten sieht das Landesbeamtengesetz die Einschaltung des Amtsarztes als Fachgutachter vor. Er soll für den Dienstherrn ermitteln, ob und gegebenenfalls welche gesundheitlichen Einschränkungen des Betroffenen bei der Fortführung des bestehenden Dienstverhältnisses zu berücksichtigen sind.
Im vorliegenden Fall war aber lediglich der Auftrag erteilt worden zu prüfen, ob bei dem Betroffenen Anzeichen für einen Alkoholmißbrauch vorliegen und ihn gegebenenfalls über eventuelle erforderliche Therapiemaßnahmen zu beraten. Anhaltspunkte für eine generelle Dienstunfähigkeit waren (noch) nicht erkennbar. Eine Verpflichtung, sich untersuchen zu lassen, bestand für den Betroffenen nicht. Die Untersuchung erfolgte mithin auf freiwilliger Grundlage. Folglich war die Übermittlung des Untersuchungsergebnisses an den Dienstherrn ebenfalls nur auf freiwilliger Grundlage, d. h. mit Einwilligung des Betroffenen, zulässig.
Sofern der Dienstherr eine amtsärztliche Begutachtung aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs veranlaßt, muß dies sowohl dem Betroffenen wie auch dem Amtsarzt gegenüber in dem Gutachtenauftrag zum Ausdruck gebracht werden. Nur unter dieser Voraussetzung hat der Betroffene dann die Möglichkeit zu prüfen, ob für ihn insoweit tatsächlich eine Obliegenheit zur amtsärztlichen Begutachtung besteht. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, hat der Dienstherr dann einen Anspruch darauf, "die für die Feststellung der Dienstunfähigkeit erforderlichen Untersuchungsergebnisse durch die Ärztin oder den Arzt" mitgeteilt zu bekommen.
|
||
|
Dabei ist allerdings das Erforderlichkeitsprinzip zu beachten. Soweit Befunde keinen Anlaß für gesundheitliche Bedenken ergeben, sind sie für die Personalentscheidung nicht erforderlich und dürfen deshalb auch nicht übermittelt werden. Gibt es dagegen Gründe, die gegen eine Dienstfähigkeit sprechen, müssen sie, je nach Bedeutung, gegebenenfalls bis ins Detail dem Dienstherrn mitgeteilt werden, um ihm eine ordnungsgemäße dienstrechtliche Bewertung des Vorgangs zu ermöglichen. Diese Daten sind auch deshalb für den Dienstherrn unverzichtbar, weil er sie in einem belastenden Bescheid gegenüber dem Betroffenen zur Begründung seiner Entscheidung darstellen muß.
|
||
4.11.3 |
Neuorganisation beim polizeiärztlichen Dienst notwendig
|
|
|
Das neue Landesbeamtengesetz macht im polizeiärztlichen Dienst eine sorgfältige Unterscheidung zwischen den Aufgaben bei der Krankenbehandlung, der Gewährung von Heilfürsorge und der gutachterlichen Tätigkeit notwendig. Die Aktenführung muß dementsprechend neu organisiert werden.
Polizeibeamte unterliegen wegen der von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben in der Regel einem besonderen gesundheitlichen Risiko. Um die Bereitschaft zu einem notwendigen körperlichen Einsatz zu fördern, wurde für diese Personengruppe ein Anspruch auf besondere Heilfürsorge gegenüber dem Dienstherrn geschaffen. Es wurde ein eigener polizeiärztlicher Dienst eingerichtet, der die speziellen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes einschätzen kann und deshalb für die Behandlung wie auch für die Begutachtung von Erkrankungen der Polizeibeamten besonders qualifiziert ist.
Die im polizeiärztlichen Dienst tätigen Ärzte werden in drei unterschiedlichen Funktionen tätig:
Prinzipiell steht es Polizeibeamten frei zu entscheiden, ob sie sich zur ärztlichen Behandlung an den Polizeiarzt wenden oder einen privaten Arzt ihrer Wahl aufsuchen. Neu eingestellte Beamte werden dagegen in der Regel innerhalb der ersten fünf Jahre ihrer Dienstzeit bzw. bis zur Erreichung des 25. Lebensjahres verpflichtet, den Polizeiarzt für Behandlungszwecke in Anspruch zu nehmen, wenn sie Leistungen aus der Heilfürsorge erhalten wollen. Der polizeiärztliche Dienst in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung, der dort die Behandlungsaufgaben wahrnimmt, begutachtet üblicherweise auch die Polizeifähigkeit der Beamten nach Ablauf der Probezeit.
Soweit bisher im polizeiärztlichen Dienst schriftliche Unterlagen entstanden, wurden diese in einer einheitlichen Krankenakte
zusammengefaßt. Die Aufsicht für den polizeiärztlichen Dienst oblag dem leitenden Polizeiarzt. Neben der ärztlichen Tätigkeit war er auch für die verwaltungsrechtlichen Entscheidungen über die Gewährung von Heilfürsorge sowie für die Erstellung von Gutachten für den Dienstherrn zuständig.
Das neue Personalaktenrecht hat nun auch im Bereich der Heilfürsorge eine räumliche, organisatorische und personelle Abschottung ausdrücklich vorgeschrieben, weil der Gesetzgeber hier die Möglichkeit unvertretbarer Interessenkollisionen gesehen hat. Die Gefahr der bewußten oder unbewußten Beeinflussung von Personalentscheidungen durch die Kenntnis von Heilfürsorgedaten oder der Krankengeschichte (als behandelnder Arzt) ist ungleich höher als bei anderen Verwaltungsverfahren. Die Polizeidienststellen müssen deshalb die notwendigen räumlichen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen für die Gewährleistung der vorgeschriebenen Abschottung der Heilfürsorge von der übrigen Personalverwaltung schaffen. Es sind dabei folgende Maßgaben zu berücksichtigen:
|
||
|
Die Praxis im polizeiärztlichen Dienst entsprach bis zum Redaktionsschluß noch nicht den gesetzlichen Maßgaben. Die Krankenakten enthielten Unterlagen aus allen Tätigkeitsbereichen des ärztlichen Dienstes. Die Organisationsform des polizeiärztlichen Dienstes berücksichtigte noch nicht die erforderliche personelle Trennung der drei angesprochenen Tätigkeitsfelder. Ein besonderes Problem ist auch die Funktion des leitenden Polizeiarztes, der auf sämtliche Feststellungen und Entscheidungen des polizeiärztlichen Dienstes nicht zuletzt aufgrund seiner Aufsichtsfunktion erheblich einwirken kann. Da die Neuorganisation der Aktenführung jedenfalls auch von der künftigen Organisation des polizeiärztlichen Dienstes abhängig ist, sollte über letztere vorrangig entschieden werden.
|
||
4.11.4 |
Akteneinsichtsrecht des Personalrats
|
|
|
Arbeitsvertragsentwürfe sind nicht Bestandteile der Personalakte. Sie müssen aber mit ähnlicher Sorgfalt behandelt werden.
Das schleswig-holsteinische Mitbestimmungsgesetz gewährt den Personalräten ein umfassendes Recht, bei Entscheidungen der Verwaltung in Personalangelegenheiten mitzubestimmen. Allerdings ist die Einsichtnahme in Personalakten nur bei ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nur den von ihnen benannten Mitgliedern des Personalrats gestattet.
Eine Dienststelle fragte bei uns an, ob sie vor diesem Hintergrund verpflichtet sei, dem Wunsch des Personalrates zu entsprechen und ihm schon den Entwurf eines noch zu vereinbarenden Arbeitsvertrages zugänglich zu machen, der ein bestehendes befristetes Arbeitsverhältnis mit einem Mitarbeiter verlängern sollte. Der Personalrat gebe sich nicht mit einer Information über die zu vereinbarenden Vertragsdaten zufrieden, sondern bestehe darauf, den gesamten Entwurfstext vorgelegt zu bekommen.
Der bloße Entwurf eines Arbeitsvertrages entfaltet noch keine Rechtswirkung gegenüber dem Mitarbeiter und berührt damit nicht sein Grundverhältnis zur Beschäftigungsdienststelle. Er gehört formal noch nicht zur Personalakte. Auch die sichere Erwartung, er werde in absehbarer Zeit Personalaktenbestandteil, führt nicht zu einer Art "vorgezogener Personalakteneigenschaft". Allerdings ist die besondere, aus dem Personalaktenrecht herzuleitende Schutzbedürftigkeit der Daten zu berücksichtigen. Es kann daher in einem solchen Fall nicht ohne weiteres von einem Einsichtsrecht des Personalrats in Arbeitsvertragsentwürfe ausgegangen werden.
|
||
|
Enthält ein Entwurf nämlich mehr Daten, als der Personalrat für seine Entscheidungsfindung benötigt, muß von einer Einsichtnahme abgesehen werden. Statt dessen sind nur die tatsächlich erforderlichen Daten weiterzugeben. Was als erforderlich anzusehen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.
|