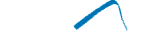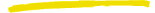4.4 Soziales
4.4.1 Sicherer Transport von Dokumenten – sicher nicht im Kalender
Bei einem Hausbesuch von Klienten verlor ein Mitarbeiter einer sozialen Einrichtung die Dokumente mit personenbezogenen Angaben einer anderen von der Einrichtung betreuten Person. Die Unterlagen wurden bei dem nächsten Hausbesuch einer Kollegin des verursachenden Mitarbeiters übergeben. Zu dem Verlust der Unterlagen kam es, da der Mitarbeiter diese bei deren Erhalt in seinen Kalender legte. Beim Notieren eines neuen Termins müssen die Unterlagen bei der anderen Familie aus dem Kalender gefallen sein.
Die verantwortliche Stelle führte umgehend Gespräche mit dem Mitarbeiter. Er konnte nicht erklären, warum er die Unterlagen nicht bis zum nächsten Hausbesuch im Büro aufbewahrt hatte. Er gab zudem an, keine Tasche zu nutzen, sondern den Kalender händisch zu transportieren. Es folgte eine deutliche Untersagung dieses Vorgehens durch den Arbeitgeber und eine Abmahnung. Organisatorische Maßnahmen in Form einer Dienstanweisung zum Transport von Unterlagen wurden ebenfalls ergriffen. Die Dienstanweisung beinhaltete insbesondere, dass Unterlagen von Klienten die Büroräumlichkeiten nicht verlassen dürfen. Eine Mitnahme der Unterlagen darf zukünftig nur in Ausnahmefällen in einer verschlossenen Tasche erfolgen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Daten an unbefugte Dritte gelangen.
Die Dienstanweisung erfolgte zunächst nur mündlich während einer Dienstbesprechung. Zur leichteren Nachschlagbarkeit in zukünftigen Situationen und auch um zu gewährleisten, dass nicht nur die in der Besprechung anwesenden Mitarbeiter Kenntnis von der Dienstanweisung erlangen, müssen Dienstanweisungen dieser Art jedoch verschriftlicht werden. Von Bedeutung war in diesem Zusammenhang die Konkretisierung von Ausnahmefällen, in denen eine Mitnahme von Unterlagen doch erlaubt ist. Auf diese Weise schafft der Arbeitgeber für die Beschäftigten die hinreichende Transparenz für die Umsetzung der Dienstanweisung. Maßgebend für Ausnahmefälle ist gegebenenfalls auch das Vorhandensein einer Arbeitsumgebung außerhalb des Büros, in welcher die unbefugte Einsichtnahme durch Bekannte, Familienangehörige oder andere Dritte ausgeschlossen werden kann. Hierzu zählen etwa auch Erwägungen zur Anzahl der mitgeführten Akten, zur Sensibilität der Daten und zum beabsichtigten Zeitraum der Bearbeitung außerhalb der Büroräume. Weiterhin ist es sinnvoll, bei Unsicherheiten bezüglich des Vorliegens von Ausnahmefällen Rücksprache mit den Vorgesetzten zu nehmen.
Das Prüfverfahren konnte mit abschließenden Hinweisen für die Dienstanweisung beendet werden.
Was ist zu tun?
Entscheiden sich Verantwortliche dafür, die Bearbeitung von Unterlagen außerhalb der Büroräume zu erlauben, so haben diese für ihre Mitarbeitenden datenschutzrechtlich angemessene Vorgaben zu treffen, unter welchen Voraussetzungen Unterlagen mit personenbezogenen Daten ausnahmsweise transportiert werden dürfen und unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Mitnahme von Unterlagen erfolgen darf.
4.4.2 Unbefugter Datenaustausch zwischen Mitarbeitern im Jugendamt
Einen Fehler zu machen ist verzeihlich, den Fehler aber nicht eingestehen zu wollen eher nicht. Das gilt auch für die Beschäftigten in einem Jugendamt.
Eine Beschwerdeführerin schilderte uns ihre Befürchtung, dass sich zwei Beschäftigte aus unterschiedlichen Fachdiensten eines Jugendamtes unbefugt untereinander über ihre familiäre Situation ausgetauscht hätten. Ihre zwei Kinder erhielten unterschiedliche Leistungen des Jugendamtes und wurden daher jeweils von einem der zwei Beschäftigten aus den jeweiligen Fachdiensten getrennt voneinander betreut.
Nicht immer dürfen sich Beschäftigte eines Jugendamtes untereinander über Betroffene austauschen. Das Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) enthält hierzu eine klare Vorgabe. Betroffene Personen haben den gesetzlichen Anspruch darauf, dass Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der Jugendhilfe erhoben wurden, nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammenhangs erforderlich ist.
Um prüfen zu können, ob dieser Grundsatz der Zweckbindung bei der Datenverarbeitung beachtet wurde, leiteten wir ein Verwaltungsverfahren der Datenschutzaufsicht ein. Das Jugendamt wurde um eine Stellungnahme gebeten. Die erste Stellungnahme, die wir erhielten, war kurz und knapp. Die zwei von der Beschwerdeführerin namentlich benannten Beschäftigten wären befragt worden und hätten glaubhaft versichert, dass es keinen Datenaustausch gegeben habe. Alle Informationen habe man stets von der Beschwerdeführerin erhalten. Die Beschwerdeführerin sei sehr redselig und könne sich vielleicht nicht mehr genau daran erinnern, was sie welchem Mitarbeiter wann erzählt habe. Rums, das hatte gesessen!
Die Beschwerdeführerin war fassungslos und blieb bei ihrer Darstellung. Also wurde das Jugendamt erneut um Stellungnahme gebeten. Wieder lautete die Antwort, dass auch nach erneuter Prüfung kein unbefugter Datenaustausch habe festgestellt werden können. Beide Beschäftigten hätten erneut glaubhaft versichert, dass der befürchtete Datenaustausch nicht stattgefunden habe. Zweifel an den Aussagen der Beschäftigten gebe es nicht. Die Beschwerdeführerin war jedoch verzweifelt und wollte schon aufgeben.
Wir sicherten der Beschwerdeführerin weitere Unterstützung zu und ermutigten diese, die ihr vorliegenden Unterlagen auf Hinweise noch einmal zu überprüfen. Und siehe da, in einem Schreiben, welches der Beschäftigte A an das Familiengericht geschickt hatte, fand sich eine Information, die sie nur dem anderen Beschäftigten B mitgeteilt hatte. Die Beschwerdeführerin hatte bei dem Beschäftigten B einen Antrag gestellt und diesem gegenüber bei einer persönlichen Vorsprache begründet. Entscheidend war der zeitliche Ablauf. Wie konnte der Beschäftigte A von diesem Antrag bei seinem Kollegen B und der Antragsbegründung wissen und wie konnte er diese Informationen in seinem Schreiben an das Familiengericht aufnehmen, wenn doch die Beschwerdeführerin nachweislich erst nach Versand dieses Schreibens bei ihm vorgesprochen hatte?
Mit diesen Informationen hörten wir das Jugendamt ein drittes Mal an. Diesmal kam die Stellungnahme noch später. Und nun wurde eingeräumt, dass sich die zwei Beschäftigten in einem kollegialen Tür- und Angel-Gespräch über die Beschwerdeführerin ausgetauscht hätten, was eine Datenschutzverletzung darstelle.
Endlich, nach über acht Monaten, konnten wir der Beschwerdeführerin mitteilen, dass Sie recht hatte. Der Datenschutzverstoß wurde beanstandet.
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |