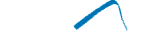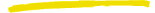4.2 Polizei und Verfassungsschutz
4.2.1 Auskunftsrecht betroffener Personen bei der Polizei
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Daten die Polizei über Sie speichert und wie Sie darauf Zugriff erhalten können? Ob nach einem Verkehrsverstoß, einer Anzeige oder anderen polizeilichen Vorgängen – es kann Situationen geben, in denen Sie wissen möchten, welche Informationen zu Ihrer Person bei der Polizei gespeichert sind. Die gute Nachricht: Sie haben ein Recht darauf, Auskunft zu erhalten. Aber wie genau funktioniert das? Welche Hürden müssen überwunden werden? Und worauf sollten Sie achten?
Worauf stützt sich Ihr Recht auf Auskunft?
Mittlerweile sind viele Menschen damit vertraut, bei Unternehmen und öffentlichen Stellen auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Auskunft über ihre personenbezogenen Daten zu beantragen. Was viele nicht wissen: Daten, die zur Gefahrenabwehr oder zur Strafverfolgung verarbeitet werden, sind vom Anwendungsgebiet der DSGVO ausgenommen. Der Anspruch auf Auskunft ergibt sich in diesem Fall aus § 33 Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Bei Daten, die von der Polizei zu anderen Zwecken verarbeitet werden (z. B. für Arbeitsverhältnisse), greift jedoch wieder die DSGVO.
In beiden Fällen gilt: Sie haben das Recht zu erfahren, ob und welche Daten die Polizei über Sie gespeichert hat.
Wer kann Auskunft beantragen?
Jede betroffene Person kann einen Antrag stellen. Dazu gehören:
- Sie selbst,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person (z. B. ein Anwalt),
- Ihre gesetzlichen Vertreter (bei Minderjährigen).
Wichtig: Bei Minderjährigen ab 14 Jahren kann die Auskunft direkt an die betroffene Person erteilt werden, sofern die Einsichtsfähigkeit gegeben ist.
Wie stellen Sie einen Antrag auf Auskunft?
Ein Antrag auf Auskunft ist formlos möglich. Es wird jedoch empfohlen, ihn schriftlich zu stellen. In Schleswig-Holstein werden alle Anträge auf Auskunft zentral durch das LKA in Kiel bearbeitet. Anträge, die auf anderen Dienststellen eingehen, werden dorthin weitergeleitet.
Was sollten Sie in den Antrag schreiben?
- Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum.
- Einen Hinweis darauf, dass Sie eine Auskunft über Ihre gespeicherten Daten beantragen.
- Wenn Sie spezifische Informationen wünschen, die sich z. B. auf bestimmte Daten, Vorgänge oder Ereignisse beziehen, ist es hilfreich, diese ebenfalls im Antrag zu benennen.
Tipp: Sie müssen nicht begründen, warum Sie die Informationen haben möchten. Die Polizei ist verpflichtet, Ihnen Auskunft zu erteilen.
Wie weisen Sie gegenüber der Polizei Ihre Identität nach?
Die Polizei muss sicher sein, dass sie die Informationen an die richtige Person herausgibt. Häufig wird daher eine Kopie des Personalausweises verlangt.
Wichtige Hinweise zur Ausweiskopie:
- Sie können nicht notwendige Daten schwärzen, z. B. die Seriennummer oder das Lichtbild.
- Erforderliche Angaben sind: Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Gültigkeitsdauer und Geburtsort.
Gut zu wissen: Die Kopie darf nur für die Bearbeitung des Antrags genutzt und muss danach gelöscht werden.
Welche Informationen erhalten Sie?
Sie haben Anspruch auf alle personenbezogenen Daten, die bei der Polizei gespeichert sind. Dazu gehören auch:
- eine Übersicht aller Vorgänge und Dateien zu Ihrer Person
sowie Informationen zu:
- dem Zweck der Datenverarbeitung,
- dem Zeitpunkt der Speicherung und Löschfristen,
- Übermittlungen an andere Stellen.
Einschränkend gilt: Daten Dritter, die mit Ihren Informationen verknüpft sind, werden geschwärzt oder ausgeschlossen.
Besonderheiten bei Verbunddateien
Personenbezogene Daten, die in Verbunddateien gespeichert sind wie beispielsweise INPOL (das Informationssystem der Polizei) oder PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund), können bundesweit abgerufen werden. Auch solche Daten sind von Ihrem Auskunftsrecht umfasst. Hierbei gibt es jedoch eine Besonderheit:
Die Landespolizei muss Ihnen Auskunft über Daten geben, die sie selbst in solche Systeme eingestellt hat. Für Daten, die von anderen Behörden gespeichert wurden, sind diese zuständig.
Gut zu wissen: Falls Daten aus Verbunddateien für Sie relevant sind und Sie die einspeichernde Behörde nicht kennen, können Sie zusätzlich beim Bundeskriminalamt (BKA) darüber Auskunft beantragen.
Wie lange dauert die Bearbeitung eines Antrags?
Anders als in der DSGVO nennt das LDSG keine Frist für die Beantwortung des Auskunftsersuchens. Die Polizei sollte Ihren Antrag daher grundsätzlich so bald wie möglich beantworten. Natürlich ist der Aufwand von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. In der Regel sollte eine Antwort innerhalb eines Monats möglich sein. In komplexeren Fällen kann die Bearbeitung auch bis zu drei Monaten in Anspruch nehmen.
Tipp: Sollten Sie nach Ablauf dieser Fristen keine Antwort erhalten, fragen Sie bitte bei der Polizei direkt nach. Bei Problemen können Sie sich an den behördlichen Datenschutz der Landespolizei (siehe Kasten) oder an uns als zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
Was passiert, wenn die Auskunft verweigert wird?
In bestimmten Fällen kann die Polizei die Auskunft einschränken oder sogar verweigern. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Erteilung der Auskunft die öffentliche Sicherheit oder ein Ermittlungsverfahren gefährden würde.
Wenn die Auskunft ganz oder teilweise verweigert wird, müssen Sie im Regelfall darüber informiert und die Entscheidung muss Ihnen gegenüber begründet werden. Die Unterrichtung und die Begründung dürfen jedoch unterbleiben, wenn bereits diese Information eine Gefährdung darstellt.
Sollten Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung haben, können Sie sich an uns wenden. Wir dürfen Ihnen zwar auch nicht mehr mitteilen als die Polizei, können aber prüfen, ob das Zurückhalten der Informationen rechtmäßig erfolgt ist. Daneben besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Einschränkung der Auskunft gerichtlich überprüfen zu lassen.
Transparenz und Verständlichkeit: Datenverarbeitung einfach erklärt
Die Polizei muss Ihnen die Informationen in verständlicher Sprache und in einer klaren Form mitteilen. Dazu gehört auch, dass Fachbegriffe oder Verweise auf Systeme (wie z. B. INPOL oder PIAV) erklärt werden. Falls Sie Fragen zu bestimmten Informationen haben, zögern Sie nicht, diese zu stellen!
Fallen Kosten für Auskunftsersuchen an?
In der Regel ist die Erteilung einer Auskunft kostenfrei. Ausnahmen können in seltenen Fällen gemacht werden, etwa wenn ein Antrag offensichtlich unbegründet oder exzessiv gestellt wird. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn wiederholt ähnliche Anfragen eingereicht werden, die keinen neuen Informationsgewinn bieten. Sollte die Polizei in einem solchen Fall Gebühren erheben wollen, muss sie Sie im Voraus darüber informieren.
Fazit: Ihr Recht auf Auskunft – nehmen Sie es wahr!
Die Polizei speichert Daten zu Ihrer Person aus verschiedenen Gründen. Als betroffene Person haben Sie ein Recht darauf zu wissen, welche Informationen vorliegen. Ein Antrag auf Auskunft ist unkompliziert und ohne große Hürden möglich.
Nutzen Sie Ihr Recht und sorgen Sie für Klarheit. Falls Probleme auftreten, stehen Ihnen die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Polizeibehörden und die Datenschutzaufsichtsbehörden als Ansprechpartner zur Seite.
Ansprechpartner bei der Landespolizei
LKA 122 (Bearbeitung von Auskunftsersuchen)
Mühlenweg 166
24116 Kiel
Behördliche Datenschutzbeauftragte
Mühlenweg 166
24116 Kiel
Tel.: 0431 160-0
E-Mail: StSt1.Kiel.LPA@polizei.landsh.de
4.2.2 INPOL-Abfrage
Sind polizeiliche Standardmaßnahmen in Form von Abfragen im Informationssystem der Polizei (INPOL) datenschutzrechtlich völlig unproblematisch? Nein! Doch genau dies war die Auffassung einer Polizeidirektion, nachdem sich eine Person über eine Abfrage in INPOL beschwert hatte.
Der INPOL-Abfrage vorausgegangen war der Versuch, auf einer Polizeidienststelle Anzeige zu erstatten. Weil die Anzeige nicht aufgenommen wurde, reagierte die Person aufgebracht und sehr emotional. Sie verließ sogar kurzzeitig die Dienststelle, um dann kurze Zeit später noch einmal dort vorzusprechen – mit unverändertem Ergebnis. Knapp zwei Wochen später erschien sie noch einmal kurz auf der Wache, weil sie eine Beschwerde vorbereiten wollte. Dazu erkundigte sie sich nach der Dienstnummer des Beamten, mit dem sie gesprochen hatte. Bei diesem Besuch wurde sie gebeten, sich auszuweisen. Kurz nach Verlassen der Dienststelle wurden die Daten der Person in INPOL abgefragt.
Durch ein Auskunftsersuchen bei der Landespolizei erhielt sie später Kenntnis von dieser Abfrage. Auf ihre Beschwerde hin teilte man ihr lediglich mit, dass sich die Abfrage auf § 195 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) stützt und die Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten. Weil sie diese Auskunft nicht nachvollziehen konnte, beschwerte sie sich beim ULD.
§ 195 LVwG (siehe Kasten) erlaubt den Abgleich personenbezogener Daten mit polizeilichen Dateien für bestimmte Personengruppen zu verschiedenen Zwecken. Die Antwort der Polizei auf die Beschwerde enthielt keine Hinweise darauf, welcher Fall des § 195 LVwG vorgelegen hat noch warum die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Sie war damit für die betroffene Person tatsächlich nicht nachvollziehbar.
§ 195 LVwG – Datenabgleich
(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten der in den §§ 218, 219 sowie § 179 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a genannten Personen mit dem Inhalt polizeilicher Dateien im Rahmen der Zweckbindung dieser Dateien abgleichen. Personenbezogene Daten anderer Personen kann die Polizei abgleichen, wenn Tatsachen dafür sprechen, dass dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich erscheint. Die Polizei kann ferner im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangte personenbezogene Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen. Ein Abgleich der nach § 179 Abs. 4 erlangten personenbezogenen Daten ist nur mit Zustimmung der betroffenen Person zulässig.
Erst im Rahmen der Überprüfung durch das ULD wurde mitgeteilt, dass die betroffene Person als „Verhaltensstörer“ nach § 218 LVwG abgefragt worden sei. Die Abfrage sei rechtmäßig gewesen und „insgesamt als polizeiliche Standardmaßnahme als völlig unproblematisch zu bewerten“.
Doch gerade bei „polizeilichen Standardmaßnahmen“, also Maßnahmen, die häufig und relativ niederschwellig durchgeführt werden, besteht die reale Gefahr, es mit den gesetzlichen Voraussetzungen nicht ganz so genau zu nehmen. Für eine Abfrage in Verbindung mit § 218 LVwG muss beispielsweise „die öffentliche Sicherheit durch das Verhalten von Personen gestört oder im einzelnen Fall gefährdet“ werden. Dafür wurde jedoch im Rahmen der Überprüfung keine tragfähige und nachvollziehbare Begründung gegeben. Sowohl für die Entgegennahme einer Anzeige als auch für die Bearbeitung einer Beschwerde über einen Beamten war die Landespolizei der richtige Ansprechpartner. Allein der Umstand, dass Gespräche „schwierig“ verlaufen und Bürger emotional reagieren, begründet noch keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Darüber hinaus erfolgte die Abfrage erst knapp zwei Wochen nach dem „schwierigen“ Gespräch. Im Ergebnis wurde daher gegenüber der Polizeidirektion eine Verwarnung ausgesprochen.
Was ist zu tun?
Sofern sich Bürgerinnen und Bürger über polizeiliche Maßnahmen beschweren, sollte ihnen neben den Rechtsgrundlagen auch erläutert werden, warum die Voraussetzungen dafür in dem konkreten Fall vorgelegen haben. Dies würde zusätzlich die Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und Gerichte erleichtern. Insbesondere bei „polizeilichen Standardmaßnahmen“ sollte die Sensibilität für die gesetzlichen Voraussetzungen noch mehr geschärft werden.
4.2.3 Abfrage aus dem Fahreignungsregister (FAER)
Das Fahreignungsregister wird beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) geführt und darin werden Informationen zu Verkehrsverstößen, Punkten in Flensburg und Entziehungen der Fahrerlaubnis gespeichert. Es dient dazu, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Fahrer zu erfassen, die gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Das FAER erfüllt damit einen wichtigen Zweck.
Im Rahmen einer Verkehrsordnungswidrigkeit wollte die zuständige Behörde eines Landkreises wissen, ob der mutmaßliche Fahrer bereits im Fahreignungsregister (FAER) vermerkt ist. Die Daten wurden also kurzerhand abgerufen – noch bevor überhaupt feststand, wer eigentlich am Steuer saß. Ist das zulässig?
Vielleicht fragen Sie sich: Darf eine Behörde nicht einfach nachschauen? Tatsächlich nicht, denn der Zugriff auf solche Daten unterliegt gesetzlichen Regeln. Grundsätzlich gilt:
- Nur wenn es auch „erforderlich“ ist – Das steht so in § 28 Abs. 2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). Ein Abruf muss einen klaren Zweck haben und zur Erreichung dieses Zweckes auch erforderlich sein.
- Nur unter Beachtung datenschutzrechtlicher Grundsätze – § 47 Nr. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) betont die Zweckbindung, die Erforderlichkeit sowie die Verhältnismäßigkeit.
Auch mit Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz werden Abfragen aus dem FAER auch im Rahmen von Ermittlungen regelmäßig erst dann angezeigt sein, wenn sich ein hinreichender Tatverdacht abzeichnet. So werden unnötige Abfragen vermieden.
Anders gesagt: Ohne Klarheit darüber, wer der Fahrer war, ist der Blick ins FAER voreilig und überflüssig. Schlimmer noch: Es könnte die Falschen treffen.
Was bedeutet das konkret? Ein Abruf aus dem FAER ist erst nach dem Abschluss der Ermittlungen zulässig, wenn unter Berücksichtigung der Äußerung des Betroffenen und etwaiger Zeugenaussagen ein Bußgeldbescheid in Betracht kommt.
Leider kommt es in Schleswig-Holstein immer wieder zu solch verfrühten Abfragen. In der Regel soll dadurch Zeit gespart werden. Durch die hohen Fallzahlen finden viele Arbeitsschritte automatisiert oder zumindest teilautomatisiert statt. Dabei entscheidet jede Ordnungswidrigkeitenbehörde selbst über ihre Arbeitsprozesse.
In anderen Bundesländern wie z. B. in NRW sind Abfragen aus dem FAER vor Abschluss der Ermittlungen durch einen landesweit gültigen Erlass des Innenministeriums ausgeschlossen. So etwas würde auch in Schleswig-Holstein für mehr Klarheit unter den Verkehrs-OWI-Behörden sorgen. Aber auch ohne einen solchen Erlass ist die Rechtslage eindeutig.
Was ist zu tun?
Daten aus dem Fahreignungsregister dürfen erst dann abgerufen werden, wenn die Fahrerin oder der Fahrer hinreichend ermittelt wurde und der Abruf tatsächlich erforderlich ist. Bußgeldbehörden sollten ihre Verfahren daraufhin überprüfen und ihre Mitarbeitenden entsprechend sensibilisieren.
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |