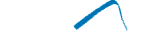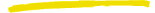4.7 Wissenschaft und Bildung
4.7.1 Landesnetz Bildung (LanBSH) jetzt auf sicheren Beinen
Es wurde ein zentrales Konzept für eine einheitliche Informationstechnologie in den Schulverwaltungen fertiggestellt. Nach Abschluss der Pilotierungsphase beginnt – angefangen bei den Gymnasien – die Einführung datenschutzkonformer IT-Systeme in den Schulverwaltungen.
Das vom ULD eingeforderte IT-Konzept (29. TB, Tz. 4.7.2) wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Finanzministerium, Bildungsministerium, den kommunalen Landesverbänden, den Schulträgern und dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz erarbeitet. Auf der Basis der vereinbarten Systemkonzepte gehen nun Rechnersysteme in vielen Schulverwaltungen des Landes in den Echtbetrieb. Diese Schulverwaltungsrechner sind standardisiert konfiguriert und in das Landesnetz eingebunden. So ist auch eine sichere Internetanbindung der Schulverwaltungen möglich.
Die bisher beim Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) vorliegenden Anmeldungen für einen solchen Anschluss zeigen, dass viele Schulleitungen und Schulträger inzwischen von diesem Konzept überzeugt sind.
4.7.2 Wissensdefizite bei Schulleiterinnen , Schulleitern und Schulsekretärinnen
Eingaben von Betroffenen und Anfragen aus Schulleitungen und von Schulsekretärinnen zeigen uns, dass Informationsdefizite in Bezug auf die bestehende Rechtslage und die Umsetzung dieser Normen bestehen.
So erfreulich die Umsetzung des LanBSH-Konzepts (Tz. 4.7.1) auch ist, bei der konkreten Anwendung der Technik in den Schulverwaltungen dürfen die Möglichkeiten des Datenschutzes nicht durch fehlendes Wissen über das Datenschutzrecht und die technischen Sicherungen konterkariert werden. Das Angebot der DATENSCHUTZAKADEMIE (DSA), Schulsekretärinnen in diesem Sektor fortzubilden, findet derzeit immer weniger Resonanz, offensichtlich weil die Schulträger immer weniger Geld für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Schulsekretärinnen scheinen insofern am Ende der Prioritätenkette zu stehen, obwohl sie tagtäglich mit sensiblen personenbezogenen Daten umgehen. Ein Eckpfeiler des LanBSH-Konzepts ist die datenschutzrechtliche Schulung. Ohne diese ist eine sichere und datenschutzkonforme elektronische Datenverarbeitung nicht möglich.
In den letzten Jahren nahm die Notwendigkeit der Online-Kommunikation der Schulverwaltungen mit anderen öffentlichen Stellen (z. B. dem Statistischen Amt, Bildungsministerium usw.) immer mehr zu.
Dieser Entwicklung wurde durch die Schaffung des Landesnetzes Bildung (LanBSH) Rechnung getragen. In Zusammenarbeit des Bildungs- und Finanzministeriums, des IQSH, den Schulträgern und des ULD wurde ein technisches Konzept entwickelt, welches die sichere Anbindung der Schulverwaltungsrechner über das Landesnetz an das Internet möglich macht. Es umfasst neben der technischen Ausgestaltung der Hardware nach genau festgelegten Kriterien auch die Bereitstellung der erforderlichen schriftlichen Verfahrensdokumentation für das EDV-Verfahren. Daneben enthält eine Dienstanweisung detaillierte Regelungen für die Nutzer der Schulverwaltungsrechner.
Auch bei den für die Datenverarbeitung verantwortlichen Schulleitungen besteht ein erhöhter Ausbildungsbedarf. So existiert z. B. eine große Unsicherheit, welche Daten von Schülerinnen und Schülern auf der Schulhomepage präsentiert werden dürfen. Die Schulleiterschulung der DSA wurde bis vor einigen Jahren regelmäßig und mit großem Erfolg in Zusammenarbeit mit dem IQSH durchgeführt, aber inzwischen nicht mehr finanziell unterstützt. Schulverwaltungen beginnen damit, die Daten der Schülerinnen und Schüler ausschließlich automatisiert zu speichern. Dabei sind genaue Kenntnisse der Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherung sowie deren Beachtung für eine sichere personenbezogene elektronische Datenverarbeitung unabdingbar.
Um den Beteiligten eine günstige und einfache Möglichkeit der Wissensbeschaffung zu geben, hat das ULD ein „Praxishandbuch Schuldatenschutz“ herausgegeben, das den Verantwortlichen in den Schulen des Landes unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird und in dem versucht wird, in allgemein verständlicher Form alle relevanten Fragen zu beantworten. Die Broschüre ist auch im Internet verfügbar unter
![]() www.datenschutzzentrum.de/schule/praxishandbuch-schuldatenschutz.pdf
www.datenschutzzentrum.de/schule/praxishandbuch-schuldatenschutz.pdf
Was ist zu tun?
Ministerium und Schulträger sollten sicherstellen, dass genügend finanzielle Mittel bereitgestellt werden, damit die Schulleitungen, die Schulsekretärinnen und sonstige Personen, die für den Datenschutz in Schulen verantwortlich sind, die nötige Fortbildung in Anspruch nehmen können.
4.7.3 Zentrale Schülerdatenbank
Nach wie vor ist es geplant, die Bildungsverläufe jeder Schülerin und jedes Schülers von der Einschulung bis zur Schulentlassung zu verfolgen. Allerdings werden die Argumente der Datenschützer zunehmend von den Verantwortlichen zur Kenntnis genommen.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) ist nach den von der Konferenz der Datenschutzbeauftragten vorgebrachten Einwänden (29. TB, Tz. 4.7.1) von der Einrichtung einer bundesweiten Schüler- bzw. genauer gesagt Schuldatenbank abgerückt. Es besteht aber kein Grund zur Entwarnung. Es wird daran festgehalten, die Bildungsverläufe aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland auf Landesebene zu speichern und zu verfolgen. Statt der bisher geplanten Schüler-Identifikationsnummer sollen die einzelnen Schülerdatensätze nunmehr mittels einer Hashwert-Verschlüsselung versehen werden, womit Datensätze Jahr für Jahr derselben Person zugeordnet werden können. Damit, meint die KMK, sei den Einwänden der Datenschutzbeauftragten Genüge getan. Wir mussten aber signalisieren, dass dieses Abspecken der Pläne nicht ausreicht. Mit den Informationen aus den jährlich zu bildenden Gesamtdatensätzen lässt sich ohne größeres Zusatzwissen weiterhin feststellen, für welche Person diese stehen. Die KMK hält außerdem an ihrem Plan fest, für nicht näher definierte Zwecke die in den Bundesländern gespeicherten Daten temporär zusammenzuführen. Diese Planungen erscheinen uns weiterhin zu unbestimmt und unverhältnismäßig.
Was ist zu tun?
Die KMK sollte von dem Großerfassungsvorhaben gänzlich abrücken. Für die dargelegten Informationsinteressen bedarf es keiner Totalerhebung; Stichprobenerhebungen dürften genügen.
| Zurück zum vorherigen Kapitel | Zum Inhaltsverzeichnis | Zum nächsten Kapitel |