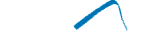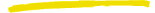6: Konferenzpapiere
Datenschutz in sozialen Netzwerken

Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich (Düsseldorfer Kreis am 08. Dezember 2011)
Der Düsseldorfer Kreis sieht die Bemühungen von Betreibern von sozialen Netzwerken als Schritt in die richtige Richtung an, durch Selbstverpflichtungen den Datenschutz von Betroffenen zu verbessern. Er unterstreicht, dass eine Anerkennung von Selbstverpflichtungen durch die Datenschutzaufsichtsbehörden gemäß § 38a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die Gewähr dafür bietet, dass die Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfüllt werden und ein Datenschutzmehrwert entsteht.
Ungeachtet dieser allgemeinen Bemühungen um eine Verbesserung des Datenschutzes in sozialen Netzwerken müssen die Betreiber schon heute das Datenschutzrecht in Deutschland beachten. Für deutsche Betreiber ist dies unumstritten. Aber auch Anbieter, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sind, unterliegen hinsichtlich der Daten von Betroffenen in Deutschland gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BDSG dem hiesigen Datenschutzrecht, soweit sie ihre Datenerhebungen durch Rückgriff auf Rechner von Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland realisieren. Dies ist regelmäßig der Fall. Die Anwendung des BDSG kann in diesen Fällen nicht durch das schlichte Gründen einer rechtlich selbstständigen Niederlassung in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes umgangen werden (§ 1 Abs. 5 Satz 1 BDSG). Nur wenn das soziale Netzwerk auch in der Verantwortung dieser europäischen Niederlassung betrieben wird, kann die Verarbeitung der Daten deutscher Nutzerinnen und Nutzer unter Umständen dem Datenschutzrecht eines anderen Staates im Europäischen Wirtschaftsraum unterliegen.
Betreiber von sozialen Netzwerken müssen insbesondere folgende Rechtmäßigkeitsanforderungen beachten, wenn sie in Deutschland aktiv sind:
- Es muss eine leicht zugängliche und verständliche Information darüber gegeben werden, welche Daten erhoben und für welche Zwecke verarbeitet werden. Denn nur eine größtmögliche Transparenz bei Abschluss des Vertrags über eine Mitgliedschaft bzw. informierte Einwilligungen gewährleisten die Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die Voreinstellungen des Netzwerkes müssen auf dem Einwilligungsprinzip beruhen, jedenfalls soweit nicht der Zweck der Mitgliedschaft eine Angabe von Daten zwingend voraussetzt. Eine Datenverarbeitung zunächst zu beginnen und nur eine Widerspruchsmöglichkeit in den Voreinstellungen zu ermöglichen, ist nicht gesetzmäßig.
- Es muss eine einfache Möglichkeit für Betroffene geben, ihre Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten geltend zu machen. Grundvoraussetzung hierfür ist die Angabe von entsprechenden Kontaktdaten an leicht auffindbarer Stelle, damit die Betroffenen wissen, wohin sie sich wenden können.
- Die Verwertung von Fotos für Zwecke der Gesichtserkennung und das Speichern und Verwenden von biometrischen Gesichtserkennungsmerkmalen sind ohne ausdrückliche und bestätigte Einwilligung der abgebildeten Person unzulässig.
- Das Telemediengesetz erfordert jedenfalls pseudonyme Nutzungsmöglichkeiten in sozialen Netzwerken. Es enthält im Hinblick auf Nutzungsdaten – soweit keine Einwilligung vorliegt – ein Verbot der personenbeziehbaren Profilbildung und die Verpflichtung, nach Beendigung der Mitgliedschaft sämtliche Daten zu löschen.
- Das direkte Einbinden von Social Plugins, beispielsweise von Facebook, Google+ oder Twitter, in Websites deutscher Anbieter, wodurch eine Datenübertragung an den jeweiligen Anbieter des Social Plugins ausgelöst wird, ist ohne hinreichende Information der Internetnutzerinnen und -nutzer und ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, die Datenübertragung zu unterbinden, unzulässig.
- Die großen Mengen an teils auch sehr sensiblen Daten, die in sozialen Netzwerken anfallen, sind durch geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen zu schützen. Anbieter müssen nachweisen können, dass sie solche Maßnahmen getroffen haben.
- Daten von Minderjährigen sind besonders zu schützen. Datenschutzfreundlichen Standardeinstellungen kommt im Zusammenhang mit dem Minderjährigenschutz besondere Bedeutung zu. Informationen über die Verarbeitung von Daten müssen auf den Empfängerhorizont von Minderjährigen Rücksicht nehmen und also auch für diese leicht verständlich sein.
- Betreiber, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sind, müssen gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 BDSG einen Inlandsvertreter bestellen, der Ansprechperson für die Datenschutzaufsicht ist.
In Deutschland ansässige Unternehmen, die durch das Einbinden von Social Plugins eines Netzwerkes auf sich aufmerksam machen wollen oder sich mit Fanpages in einem Netzwerk präsentieren, haben eine eigene Verantwortung hinsichtlich der Daten von Nutzerinnen und Nutzern ihres Angebots. Es müssen zuvor Erklärungen eingeholt werden, die eine Verarbeitung von Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer durch den Betreiber des sozialen Netzwerkes rechtfertigen können. Die Erklärungen sind nur dann rechtswirksam, wenn verlässliche Informationen über die dem Netzwerkbetreiber zur Verfügung gestellten Daten und den Zweck der Erhebung der Daten durch den Netzwerkbetreiber gegeben werden können.
Anbieter deutscher Websites, die in der Regel keine Erkenntnisse über die Datenverarbeitungsvorgänge haben können, die beispielsweise durch Social Plugins ausgelöst werden, sind regelmäßig nicht in der Lage, die für eine informierte Zustimmung ihrer Nutzerinnen und Nutzer notwendige Transparenz zu schaffen. Sie laufen Gefahr, selbst Rechtsverstöße zu begehen, wenn der Anbieter eines sozialen Netzwerkes Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer mittels Social Plugin erhebt. Wenn sie die über ein Plugin mögliche Datenverarbeitung nicht überblicken, dürfen sie daher solche Plugins nicht ohne weiteres in das eigene Angebot einbinden.